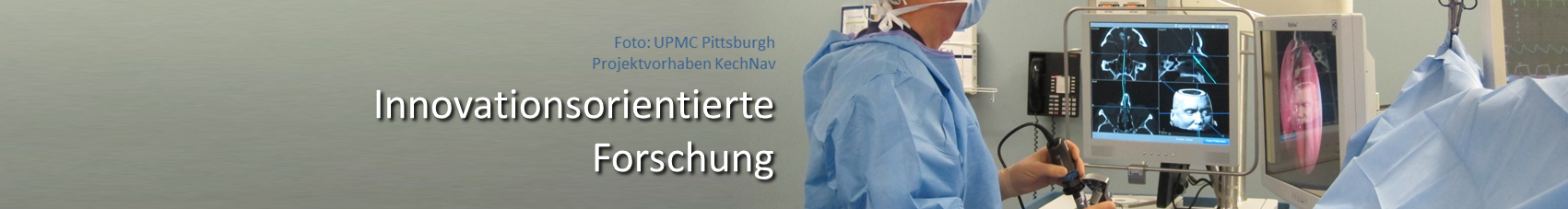|
HoliAM
Holistische Optimierung der Oberflächengüte in der additiven Fertigung von Metallen mittels Laser Powder Bed Fusion
|
|
F.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Oberflächen-Funktionalisierung7
Hochtechnologie Materialien8
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Vorhaben |
<p>Mittels Laser Powder Bed Fusion lassen sich geometrisch komplexe Bauteile aus metallischen Massivgläsern additiv herstellen. Für Hochtechnologie-Anwendungen ist deren Oberflächenrauheit jedoch zu hoch und die Nachbearbeitung kostenintensiv und für diese neuartige Materialklasse noch nicht ausreichend erforscht. Ziel ist, die Oberflächenrauheit von Zirkon-basierten metallischen Glasbauteilen, deren Materialeigenschaften ein großes Potenzial für medizinische und optische Anwendungen haben, auf < 0,05 µm zu minimieren. Dies soll durch kombinierte Nachbearbeitung durch Strahlspanen, Gleitspanen und Elektropolieren gelingen.</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Lehrstuhl Fertigungstechnik (LF), Universität Duisburg-Essen</li> <li>Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Berlin</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>4MI GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>amsight GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Diamond Tooling Systems - DTS GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>F. Gottinger Orthopädietechnik GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Heraeus AMLOY Technologies GmbH</li> <li>iWP innovative Werkstoffprüfung GmbH & Co. KG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>MPS Metal Printing Solutions GmbH</li> <li>MetShape GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Motorex GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Nanoval GmbH & Co. KG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Olympus Winter & Ibe GmbH</li> <li>OTEC Präzisionsfinish GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>plasotec GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SPECTARIS e. V. <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>Verband</sup></span></span></span></li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2249">Projektsteckbrief</a></li> </ul>
<p><strong>Förderung der Forschungskosten</strong></p>
<ul> <li>Eine öffentliche Förderung der Forschungskosten wird im Rahmen des BMWK-Programms "Industrielle Gemeinschaftsforschung" (IGF) beantragt.</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Die Administrationskosten der IGF-Forschung sind durch freiwillige Beiträge der Wirtschaft zu tragen.</li> </ul>
<p><strong>Stand der Fördermittelbeantragung</strong></p>
<ul> <li>Der Antrag wurde im März 2025 beim Projektträger des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR-PT) eingereicht.</li> <li>An der Deckung der Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen amsight GmbH, F. Gottinger Orthopädie GmbH, Heraeus AMLOY Technologies GmbH, iWP innovative Werkstoffprüfung GmbH & Co. KG und plasotec GmbH. Aktueller Deckungsgrad: 58 %.</li> </ul> |
|
Q.Scanner
Quantum Dot-basierter Mikroscanner für die dynamische Emission und Detektion von Licht für die medizinische In-Vivo-Diagnostik
|
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Hochtechnologie Materialien8
|
Vorhaben |
<p>Die Fluoreszenzmikroskopie, ein wichtiges Bildgebungsverfahren in der medizinischen Diagnostik, erfordert derzeit komplexe und kostspielige Komponenten, die mit erheblichem Justage- und Wartungsaufwand verbunden sind. Projektziel ist die Entwicklung einer kostengünstigen, wartungsarmen und platzsparenden Alternative, die die Effizienz der bestehenden Systeme übertrifft. Dazu soll ein miniaturisiertes Scanning-Gerät geschaffen werden, das einen Silizium-Mikroaktor nutzt und mit Quantum-Dots für Lichtemission und -detektion beschichtet ist, wodurch alle erforderlichen Bestandteile auf einem einzigen Chip integriert werden können.</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer ENAS, Chemnitz</li> <li>Technische Universität Chemnitz</li> <li>Institut für Angewandte Physik, Friedrich-Schiller<br /> Universität Jena</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>12-15 Unternehmen (mind. 50 % KMU)</li> </ul><p><strong>Förderung</strong></p>
<ul> <li>wird im Rahmen des BMWK-Programms "Industrielle Gemeinschaftsförderung" (IGF) beantragt</li> </ul>
<p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2196" title="KIbAH">Projektsteckbrief</a></li> </ul>
<p><strong>Stand der Fördermittelbeantragung</strong></p>
<ul> <li>Der Antrag wird voraussichtlich im Winter 2024 beim Projektträger des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR-PT) eingereicht.</li> </ul> |
|
PulseEye
Berührungslose Messung der okularen Gefäßpulswelle für eine reproduzierbare Tonometrie
|
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
|
Vorhaben |
<p>Bei der berührungslosen Tonometrie, bei der der Augeninnendruck mit Hilfe eines schmerzfreien Luftstoßes gemessen wird, werden Druckschwankungen durch die Gefäßpulsation bisher nicht berücksichtigt. Projektziel ist, die Reproduzierbarkeit der Tonometrie durch optische Messung der Gefäßpulswellen zu erhöhen und die Anzahl der notwendigen Messungen am Patienten zu reduzieren. Dazu soll die berührungslose Tonometrie durch einen optischen Aufbau erweitert werden, der die mit der Pulswelle schwankende Lichtabsorption der vorderen Augengefäße misst und die Augeninnendruckmessung zu definierten Zeitpunkten ermöglicht.</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Laser Zentrum Hannover e. V.</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>10-12 Unternehmen (mind. 50 % KMU)</li> </ul><p><strong>Förderung</strong></p>
<ul> <li>wird im Rahmen des BMWK-Programms "Industrielle Gemeinschaftsförderung" (IGF) beantragt</li> </ul>
<p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2193" title="KIbAH">Projektsteckbrief</a></li> </ul>
<p><strong>Stand der Fördermittelbeantragung</strong></p>
<ul> <li>Der Antrag wird voraussichtlich im Winter 2024 beim Projektträger des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR-PT) eingereicht.</li> </ul> |
|
KIbAH
KI basierte Automatisierung der Hebelpolitur
|
|
F.O.
|
|
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Künstl. Intelligenz, Deep Learning11
|
Vorhaben |
<p>Die Hebelpolitur ist ein essenzieller, die Güte von Hochpräzisionslinsen bestimmender Prozess, der heute noch meist manuell durchgeführt wird und für ein optimales Ergebnis erfahrenes Fachpersonal bedarf, das die in komplexer gegenseitiger Abhängigkeit stehenden Bearbeitungsparameter prozessbegleitend anpasst. In diesem Projekt soll eine automatisierte Roboter-Polierzelle dazu qualifiziert werden, den Polierschritt bedienerunabhängig, reproduzierbarer und produktiver nachzubilden. Zur Anlernung des Robotersystems sollen Prognosemodelle mit Methoden des halb-überwachten und des überwachten Lernens genutzt werden.</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Technische Hochschule Deggendorf (THD), Institut für Präzisionsbearbeitung und Hochfrequenztechnik, Teisnach</li> <li>Technische Hochschule Deggendorf THD, Technologie Campus Grafenau</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>12-15 Unternehmen (mind. 50 % KMU)</li> </ul><p><strong>Förderung</strong></p>
<ul> <li>wird im Rahmen des BMWK-Programms "Industrielle Gemeinschaftsförderung" (IGF) beantragt</li> </ul>
<p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2182" title="KIbAH">Projektsteckbrief</a></li> </ul>
<p><strong>Stand der Fördermittelbeantragung</strong></p>
<ul> <li>Der Antrag wird voraussichtlich im Winter 2024 beim Projektträger des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR-PT) eingereicht.</li> </ul> |
|
FAMOS
Faserendoskopischer Temperatursensor für harsche Umgebungsbedingungen
|
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Detektion, Diagnostik5
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Hochtechnologie Materialien8
|
Vorhaben |
<p>Aufgrund der zunehmenden Komplexität und Miniaturisierung technischer Prozesse und Geräte stoßen herkömmliche Sensorsysteme zur Temperaturmessung an ihre Grenzen. Projektziel ist die Entwicklung innovativer, präziser und zuverlässiger, dennoch ultradünner und flexibler Temperatursensoren, die auch in schwerzugänglichen Bereichen und bei harschen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Das Sensorkonzept basiert auf der temperaturabhängigen Lichtemission. Es sollen chemisch inerte und biokompatible Materialsysteme verwendet und die Sensoren auf der Facette einer optischen Glasfaser aufgebracht werden.</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover</li> <li>Zentrum für angewandte Nanotechnologie, Fraunhofer IAP, Hamburg</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>12-15 Unternehmen (mind. 50 % KMU)</li> </ul><p><strong>Förderung</strong></p>
<ul> <li>wird im Rahmen des BMWK-Programms "Industrielle Gemeinschaftsförderung" (IGF) beantragt</li> </ul>
<p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2181" title="FAMOS">Projektsteckbrief</a></li> </ul>
<p><strong>Stand der Fördermittelbeantragung</strong></p>
<ul> <li>Der Antrag wird voraussichtlich im Herbst 2025 beim Projektträger des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR-PT) eingereicht.</li> </ul> |
|
PlasmaGraph
Plasmafunktionalisierte Graphen-Feldeffekttransistoren als miniaturisierte Matrixsensoren zur Echtzeitdetektion von PFAS in Flüssigkeiten
|
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Oberflächen-Funktionalisierung7
Hochtechnologie Materialien8
Künstl. Intelligenz, Deep Learning11
|
Vorhaben |
<p>Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) sind kaum abbaubar und stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, wenn sie über Wasser- und Nahrungskreisläufe in den menschlichen Körper gelangen. Doch eine effiziente Überwachung der PFAS-Belastungen scheitert bisher an den Kosten und der Komplexität aktueller Analysemethoden. Ziel ist die Entwicklung eines miniaturisierten Multiplex-Sensorsystems zur hochsensitiven Vor-Ort-Detektion unterschiedlicher PFAS-Typen. Hierzu sollen spezifisch plasmafunktionalisierte Graphen-Feldeffekttransistoren und zur Datenanalyse ein neuronales Netzwerk genutzt werden.</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Institut für Lasertechnologie in der Medizin und Messtechnik an der Universität Ulm, Ulm</li> <li>IMMS GmbH, Illmenau</li> <li>Institut für Physikalische Chemie IPC an der Universität Jena, Jena</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>15-20 Unternehmen (mind. 50 % KMU)</li> </ul><p><strong>Förderung</strong></p>
<ul> <li>wird im Rahmen des BMWK-Programms "Industrielle Gemeinschaftsförderung" (IGF) beantragt</li> </ul>
<p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2175" title="PlasmaGraph">Projektsteckbrief</a></li> </ul>
<p><strong>Stand der Fördermittelbeantragung</strong></p>
<ul> <li>Der Antrag wird voraussichtlich im Herbst 2025 beim Projektträger des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR-PT) eingereicht.</li> </ul> |
|
OptiCer
Optimierte Herstellungsverfahren von hochtransparenten
und mechanisch höchst beanspruchbaren Keramiken
|
|
O.M.
|
|
|
Vorhaben |
<p>Die konventionelle Herstellung transparenter Keramiken basiert auf komplexen energie- und kostenintensiven Verfahren, die schwer hochskalierbar sind. Projektziel ist die Etablierung einer innovativen Herstellungsroute für polykristalline, transparente Keramiken mit hoher mechanischer Belastbarkeit und optimalen thermo-physikalischen Eigenschaften, z. B. für Hochleistungsoptiken. Anhand von Halbzeug und Gläsern vier verschiedener, aus häufig vorkommenden Geomaterialien hergestellter Materialsysteme soll ein neuartiges Hochdruck-Hochtemperatur-Verfahren validiert und verbleibende Prozesshürden ausgeräumt werden.</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Institut für Geowissenschaften,<br /> Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</li> <li>Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Dresden</li> <li>Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>ASML Berlin GmbH</li> <li>Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG</li> <li>Crystal GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup> KMU</sup></span></span></span></li> <li>dopa Entwicklungsges. für Oberflächentechnologie mbH<span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup> KMU</sup></span></span></span></li> <li>FOS Inon Optics GmbH<span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup> KMU</sup></span></span></span></li> <li>Glassomer GmbH<span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup> KMU</sup></span></span></span></li> <li>hawedia Wolfgang Schubert<span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup> KMU</sup></span></span></span></li> <li>INGENERIC GmbH</li> <li>joimax GmbH</li> <li>KARL STORZ SE & Co. KG</li> <li>KORTH KRISTALLE GmbH<span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup> KMU</sup></span></span></span></li> <li>LAYERTEC GmbH</li> <li>myStandards GmbH<span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup> KMU</sup></span></span></span></li> <li>Olympus Winter & Ibe GmbH</li> <li>phi Pharma International GmbH & Co. KG<span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup> KMU</sup></span></span></span></li> <li>Sasol Germany GmbH</li> <li>SCHOTT AG</li> <li>SEI Automotive Europe GmbH</li> <li>SPECTARIS<span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup> Verband</sup></span></span></span></li> </ul>
<p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2156" title="OptiCer">Projektsteckbrief</a></li> </ul>
<p><strong>Förderung der Forschungskosten</strong></p>
<ul> <li>Eine öffentliche Förderung der Forschungskosten wird im Rahmen des BMWK-Programms "Industrielle Gemeinschaftsförderung" (IGF) beantragt.</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Die Administrationskosten der IGF-Forschung sind durch freiwillige Beiträge der Wirtschaft zu tragen.</li> </ul>
<p><strong>Stand der Fördermittelbeantragung</strong></p>
<ul> <li>Der Antrag auf Begutachtung wurde im Februar 2025 beim Projektträger des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR-PT) eingereicht.</li> <li>An der Deckung der Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG, INGENERIC GmbH, KARL STORZ SE & Co. KG, Korth Kristalle GmbH, LAYERTEC GmbH, Olympus Winter & Ibe GmbH und phi Pharma International GmbH & Co. KG. Aktueller Deckungsgrad: 61 %.</li> </ul> |
|
SelektLas
Selektiver und schädigungsarmer Laserabtrag von Schichtsystemen auf optischen Bauelementen
|
|
O.
|
|
Oberflächen-Funktionalisierung7
|
Vorhaben |
<p>Bei Punkt- oder flächigen Fehlern in der Beschichtung hochwertiger Optiken müssen diese abgetragen und die Beschichtung repariert oder ersetzt werden. Bisher angewandte nasschemische Abtragsverfahren basieren jedoch oft auf Einsatz giftiger Chemikalien und erfordern oft einen vollständigen Schichtabtrag, während mechanische Verfahren meist nur auf planen Oberflächen anwendbar sind. Projektziel ist die Prozessentwicklung für einen schädigungsarmen, ortsoptimierten Abtrag durch Ultrakurzpulslaser. Hierfür sollen simulative Ansätze, experimentelle Untersuchungen und In situ-Messtechnik zur Parameter-Optimierung genutzt werden.</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Laserinstitut Hochschule Mittweida</li> <li>Ernst-Abbe-Hochschule, Jena</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>3D-Micromac AG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ACM Coatings GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Bühler Alzenau GmbH</li> <li>Carl Zeiss Jena GmbH</li> <li>Coherent Kaiserslautern GmbH</li> <li>HOFBAUER OPTIK Mess- & Prüftechnik <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>JENOPTIK Optical Systems GmbH</li> <li>LASER COMPONENTS Germany GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Light Conversion UAB</li> <li>n2-Photonics GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>PRIMES GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH</li> <li>TTI - Technologie-Transfer-Initiative GmbH an der Universität Stuttgart <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2095">Projektsteckbrief</a></li> </ul>
<p><strong>Förderung der Forschungskosten</strong></p>
<ul> <li>Eine öffentliche Förderung der Forschungskosten wird im Rahmen des BMWK-Programms "Industrielle Gemeinschaftsforschung" (IGF) beantragt.</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Die Administrationskosten der IGF-Forschung sind durch freiwillige Beiträge der Wirtschaft zu tragen.</li> </ul>
<p><strong>Stand der Fördermittelbeantragung</strong></p>
<ul> <li>Der Antrag wird voraussichtlich im März 2025 beim Projektträger des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR-PT) eingereicht.</li> <li>An der Deckung der Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen Carl Zeiss Jena GmbH, Coherent Kaiserslautern GmbH, HOFBAUER OPTIK Mess & Prüftechnik, JENOPTIK Optical Systems GmbH, LASER COMPONENTS Germany GmbH, Light Conversion UAB, n2-Photonics GmbH und SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH. Aktueller Deckungsgrad: 62 %.</li> </ul>
|
|
MSI-prevent
Neuartiger Ansatz multispektraler Bildgebung mit strukturierter Beleuchtung für eine verbesserte kolposkopische Krebsprävention
|
(2024-2027)
|
F.O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Laufende Projekte |
<p>Die niedrige Spezifität von Biopsieentnahmen bei der Kolposkopie zur Früherkennung intraepithelialer Neoplasien als Krebsvorstufe am Gebärmutterhals ist verantwortlich für eine hohe Morbidität und Mortalität. Ziel ist ein Bildvermessungssystem auf Basis multispektraler Bildgebung kombiniert mit strukturierter Beleuchtung, mit dem die Sensitivität und die Spezifität der Kolposkopie erheblich gesteigert werden. Dazu wird ein neuartiger Lösungsansatz mit modularem Mikrooptikaufbau verfolgt, anhand eines bestehenden Systems klinisch erprobt und bis zum Funktionsmuster für den finalen klinischen Test weiterentwickelt werden.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF23367N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Institut für Lasertechnologie in der Medizin und Messtechnik an der Universität Ulm, Ulm</li> <li>Department für Frauengesundheit, Universitätsklinik der Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen</li> <li>Fraunhofer-Institut für Lasertechnik, Aachen</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>AHF analysentechnik AG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Diaspective Vision GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Erbe Elektromedizin GmbH</li> <li>FISBA AG</li> <li>Genome Identification Diagnostics GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>HB Technologies AG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Hellma GmbH & Co. KG</li> <li>Imed medical GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Institut Prof. Dr. & Dr. Menton <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>JENOPTIK Optical Systems GmbH</li> <li>KARL STORZ SE & Co. KG</li> <li>LASER COMPONENTS Germany GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>QIOPTIQ Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>Richard Wolf GmbH</li> <li>SPECTARIS e. V. <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>Verband</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>An der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen AHF analysentechnik AG, ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG., Erbe Elektromedizin GmbH, FISBA AG, Genome Identification Diagnostics GmbH, HB Technologies AG, Hellma GmbH & Co. KG, Imed medical GmbH, JENOPTIK Optical Systems GmbH, KARL STORZ SE & Co.KG, Laser Components Germany GmbH, Laser Components Germany GmbH und Richard Wolf GmbH. Die F.O.M. bedankt sich bei im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF23367N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 745.438 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2006">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2197">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote [<em>Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. </em><em>05/2027</em>]</li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 12.11.2024 (Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik ILM)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> </li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20IndiPrint" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket MSI-prevent" abonnieren.</strong></p> |
|
IndiPrint
Automatische Chairside-Individualisierung von monolithischen keramischen Dentalrestaurationen
|
(2024-2026)
|
F.O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
3D-Visualisierung, Monitoring4
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Oberflächen-Funktionalisierung7
Hochtechnologie Materialien8
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Sonstige Metathemen13
|
Laufende Projekte |
<p>Die Fertigungsqualität individueller dentaler Restaurationen hängt stark von den handwerklichen Fähigkeiten und dem Fachwissen von Zahntechnikern oder Zahnärzten ab. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines automatisierten Fertigungsprozesses für hochwertige Individualisierungen mit einem interaktiven Chairside System zur Kolorierung. Dazu soll nach einer Farbnahme von den Nachbarzähnen durch eine Simulation die notwendige Zusammensetzung von Malfarbe und Glasur ermittelt werden. Anschließend soll diese mit kontrollierter Dosierung auf die vollkeramische Restauration automatisch aufgetragen werden.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF23188N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Inst. f. Lasertechnologie i. d. Medizin u. Messtechnik ILM a. d. U. Ulm</li> <li>Poliklinik f. Zahnärztliche Prothetik, Klinikum d. U. München, LMU</li> <li>Lehrst. f. Mikrotechnik u. Medizingerätetechnik , TU München, TUM</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>Annett Kieschnick <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Ansys GmbH</li> <li>ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Dekema Dental-Keramiköfen GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Emulation S. Hein <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>estetic ceram ag <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Gigahertz Optik GmbH</li> <li>Institut Straumann AG</li> <li>Ivoclar Vivadent AG</li> <li>Martin GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>r2 dei ex maschina GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Renfert GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Sirius Ceramics Carsten Fischer GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Sirona Dental System GmbH</li> <li>VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & CO. KG</li> </ul>
<p>An der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen Ansys GmbH, Martin GmbH, Institut Straumann Institut AG, Ivoclar Vivadent AG, Sirona Dental System GmbH und VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG. Die F.O.M. bedankt sich bei im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF23188N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 662.291 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2060">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2170">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote [<em>Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. </em><em>05/2026</em>]</li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 29.05.2024 (Poliklinik f. Zahnärztliche Prothetik LMU)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20IndiPrint" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket IndiPrint" abonnieren.</strong></p> |
|
LabaKom
Laserbasierte Spannungskompensation bei Glassubstraten in der Dünnschichttechnologie
|
(2023-2026)
|
O.
|
|
Oberflächen-Funktionalisierung7
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Laufende Projekte |
<p>Nach der Beschichtung stehen aufgebrachte Schichten gewöhnlich unter mechanischer Spannung, die zur Verformung des Substrats führen kann. Oft ist mit herkömmlichen Methoden keine ausreichende Korrektur zu erzielen. Projektziel ist die Entwicklung eines kostengünstigen Verfahrens zur langzeitstabilen Kompensation von Zug- und Druckspannungen bei Glassubstraten, das die großflächige und schnelle Korrektur auch komplexer Verformungen ermöglicht. In die rückseitige Oberfläche sollen durch Laserbestrahlung Spannungen eingebracht und die dadurch bewirkte Formkorrektur experimentell und numerisch optimiert werden.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF23076N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>IFNANO Institut für Nanophotonik Göttingen e. V.</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>AMSTOG GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Bühler Alzenau GmbH</li> <li>DIOPTIC GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li> <p>HEGLA boraident GmbH & Co. KG</p> </li> <li> <p>JENOPTIK Optical Systems GmbH</p> </li> <li>LASEROPTIK GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LaVision GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LAYERTEC GmbH</li> <li>Nagl & Vetter GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Plan Optik AG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>scia Systems GmbH</li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> <li>UltraFast Innovations GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>An der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen JENOPTIK Optical Systems GmbH, LASEROPTIK GmbH, LAYERTEC GmbH sowie UltraFast Innovations GmbH. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF23076N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 273.633 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1402">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2205">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote [<em>Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 07/2026]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundenen PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 19.11.2024 (IFNANO Göttingen)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20LabaKom" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket LabaKom" abonnieren.</strong></p> |
|
ProKos
Prozessentwicklung zum Koordinatenschleifen sprödharter Werkstoffe
|
(2023-2025)
|
F.O.
|
|
Laseroptische Medizintechnik2
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Hochtechnologie Materialien8
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Sonstige Metathemen13
|
Laufende Projekte |
<p>Die Herstellung von Kavitäten in sprödharten Werkstoffen wie Zerodur, Siliziumkarbid oder Siliziumnitrid erfolgt aktuell mittels Koordinatenschleifprozessen mit Schleifstiften und Überflutungskühlung. Typisch für diese Prozesse sind hohe Zerspankräfte, hoher Werkzeugverschleiß sowie eine geringe Produktivität. Projektziel ist eine Produktivitätssteigerung für das Koordinatenschleifen von sprödharten Werkstoffen mithilfe einer Prozessentwicklung. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung wird hierfür der Einfluss der Bahnplanung, der Kühlschmierstrategie und einer Ultraschallüberlagerung auf das Prozessergebnis ermittelt.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22984N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>FAU Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Ressourcen- und Energieeffiziente Produktionsmaschinen</li> <li>TH Deggendorf, Institut für Präzisionsbearbeitung und Hochfrequenztechnik</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>AFS Airfilter Systeme GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>DMG MORI Ultrasonic Lasertec GmbH</li> <li>Günter Effgen GmbH</li> <li>KARL STORZ SE & Co. KG</li> <li>KNOLL Maschinenbau GmbH</li> <li>Oemeta Chemische Werke GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Röders GmbH</li> <li>SCHOTT AG</li> <li>Schott Diamantwerkzeuge GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Schröder Spezialglas GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ShapeFab GmbH & Co. KG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> <li>Weiss Umformwerkzeuge GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG</li> </ul>
<p>An der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen Günter Effgen GmbH, KARL STORZ SE & Co. KG, Oemeta Chemische Werke GmbH, Schott Diamantwerkzeuge GmbH, Schröder Spezialglas GmbH und Weiss Umformwerkzeuge GmbH. Die F.O.M. bedankt sich bei im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22984N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 382.590 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1434">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2111">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 12/2025]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 31.07.2024 (TH Deggendorf, hybrid)<br /> - 05.10.2023 (TH Deggendorf, hybrid)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20ProKos" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket ProKos" abonnieren.</strong></p> |
|
tigeR
Multiskalige Risscharakterisierung in der Optikfertigung
|
(2023-2025)
|
O.
|
|
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Hochtechnologie Materialien8
Künstl. Intelligenz, Deep Learning11
Sonstige Metathemen13
|
Laufende Projekte |
<p>Bei der Optikfertigung entstehende Mikrorisse und Materialschädigungen („sub-surface damages“; SSD) setzen die Abbildungsleistung optischer Systeme herab, sind jedoch nur sehr aufwendig oder destruktiv nachzuweisen. SSD können nur durch aufwendige, kostenintensive Polier- und Finishing-Verfahren entfernt werden. Projektziele sind ein tieferes Verständnis der SSD-Entstehung und von Möglichkeiten ihrer Minimierung und Entfernung. Mithilfe multiskaliger Analysen der Oberflächenzustände soll ein hochauflösendes, zerstörungsfreies Messverfahren auf Basis optischer Kohärenztomographie entwickelt und optimiert werden.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22724N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li> <p>AG Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung, Ernst-Abbe-Hochschule, Jena</p> </li> <li> <p>Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V., Leipzig</p> </li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li> <p>ASML Berlin GMbH</p> </li> <li> <p>Carl Zeiss Jena GmbH</p> </li> <li> <p>Hellma Materials GmbH</p> </li> <li>LAYERTEC GmbH</li> <li>MABRI.VISION GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li> <p>OptoTech Optikmaschinen GmbH</p> </li> <li> <p>Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG</p> </li> <li> <p>SCHOTT AG</p> </li> <li>ShapeFab GmbH & Co. KG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li> <p>Thorlabs GmbH</p> </li> <li>Trionplas Technologies GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>VM-TIM GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>An der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen ASML Berlin GmbH, Carl Zeiss Jena GmbH, LAYERTEC GmbH, OptoTech Optikmaschinen GmbH, Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG, SCHOTT AG, Thorlabs GmbH und Trionplas Technologies GmbH. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22984N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 491.588 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1360">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2051">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 12/2025]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 06.05.2024 (Leibniz-IOM Leipzig, Leipzig)<br /> - 27.04.2023 (EAH Jena, Jena)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20tigeR" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket tigeR" abonnieren.</strong></p> |
|
BeRoH
Bedienerunabhängige Roboter-gestützte Hebelpolitur
|
(2023-2025)
|
F.O.
|
|
Laseroptische Medizintechnik2
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Sonstige Metathemen13
|
Laufende Projekte |
<p>Die Hebelpolitur von planen und sphärischen Präzisionsoptiken ist ein hochkomplexer, iterativer Prozess, der nur schwer zu automatisieren ist und daher noch manuell durchgeführt wird. Ziel von BeRoH ist es, diesen Prozess mit einem Industrieroboter vollständig bedienerunabhängig umzusetzen. Dazu wird der Roboter befähigt, eine Optik vollflächig zu polieren und interferometrisch zu vermessen. Der Polierprozess wird dann durch den Roboter entsprechend angepasst, um nach möglichst wenigen Iterationen eine vorgegebene Zielqualität zu erreichen. Hierfür wird ein mathematisches Abtragsmodell der Hebelpolitur entwickelt.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22672N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Technische Hochschule Deggendorf (THD), Institut für Präzisionsbearbeitung und Hochfrequenztechnik, Teisnach</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>ASA Astrosysteme GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Carl Zeiss Jena GmbH</li> <li>DD-Optik GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>DIOPTIC GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>JENOPTIK Optical Systems GmbH</li> <li>Leica Camera AG</li> <li>POG Präzisionsoptik Gera GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Pureon AG</li> <li>Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>Satisloh GmbH</li> <li>Stock-Konstruktion GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SwissOptic AG</li> </ul>
<p>An der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen Carl Zeiss Jena GmbH, DIOPTIC GmbH, JENOPTIK Optical Systems GmbH, POG Präzisionsoptik Gera GmbH, Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG, Satisloh GmbH und SwissOptic AG. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22672N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 262.472 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1390">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2053">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 09/2025]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 13.02.2025 (TH Deggendorf, Teisnach)<br /> - 20.02.2024 (TH Deggendorf, Teisnach)<br /> - 19.04.2023 (TH Deggendorf, Teisnach)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20BeRoH" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket BeRoH" abonnieren.</strong></p> |
|
PolyPro3D
Prozessketten zur Fertigung von Medizin-, Feinmechanik-, Individualbauteilen und Prototypen aus Kunststoff
|
(2023-2025)
|
F.M.
|
|
Oberflächen-Funktionalisierung7
|
Laufende Projekte |
<p>Nahezu alle 3D-Druck-Verfahren haben den Nachteil, raue und teilweise porenbehaftete Oberflächen zu produzieren. Ziel des Projekts PolyPro3D ist die Entwicklung neuer Prozessketten für mit erhöhter Aufbaurate additiv gefertigter Kunststoffbauteile, die eine optimierte Oberflächenqualität aufweisen. Die angestrebte Qualität soll die Produktion von z. B. tribologischen Funktionsbauteilen oder individuellen Implantaten ermöglichen. Dazu soll ein partikelfreies und selektives Laserpolieren für 3D-Kunststoffbauteile entwickelt und der 3D-Druck-Prozess in Bezug auf die Schnittstellen zur laserbasierten Nachbearbeitung angepasst werden.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22660N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li> <p>Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen</p> </li> <li>Fachhochschule Aachen</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>Aconity GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></li> <li>AIXLens GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></li> <li>Altair Engineering GmbH</li> <li>Apium Additve Technologies GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></li> <li>Clean-Lasersysteme GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></li> <li>DyeMansion GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></li> <li>H. ZANDER GmbH & Co. KG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></li> <li>Karl H. Arnold Maschinenfabrik GmbH & Co. KG <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></li> <li>Miele & Cie. KG</li> <li>Orion Additive Manufacturing GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></li> <li>Protembis GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></li> </ul>
<p>An der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten beteiligen sich bisher die Unternehmen Karl H. Arnold Maschinenfabrik GmbH & Co. KG sowie Miele & Cie. KG. Die F.O.M. bedankt sich bei im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22660N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 502.929 EUR</li> </ul>
<p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1317" title="PolyPro3D">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2041" title="Projektplan Ink-Eye">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 09/2025]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 06.02.2024 (Webkonferenz)<br /> - 23.03.2023 (Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20PolyPro3D" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket PolyPro3D" abonnieren.</strong></p> |
|
3DmiChrom
Mikro-3D-Druck von stationären Phasen für die miniaturisierte Flüssigkeitschromatographie
|
(2023-2025)
|
F.O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Detektion, Diagnostik5
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Laufende Projekte |
<p>In der Flüssigchromatographie setzen bisher eingesetzte Materialien Limitationen für eine hohe Trenneffizienz bei gleichzeitiger Miniaturisierung. Projektziel ist eine signifikante Verschiebung der Limitationen durch die additive Fertigung von Mikrosäulen im Nanometer-Präzisionsbereich, die als stationäre monolithische Festphase in ein mikrofluidisches Lab-on-a-chip-System integriert werden können. Die Mikrosäulen sollen hierfür mit der Zwei-Photonen-Lithographie gedruckt werden. Die im Mikro-3D-Druck eingesetzten Materialien sollen für die Chromatographie (z. B. Umkehrphasen, Ionenaustauscher) funktionalisiert werden.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22786N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e. V.</li> <li>Hochschule Reutlingen, Fakultät Angewandte Chemie</li> </ul>
<p><strong>AiF-Forschungsvereinigungen</strong></p>
<ul> <li>Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik e. V. (F.O.M.)</li> <li>Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e. V. (IUTA)</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>Allresist GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>BASF SE</li> <li>CS-Chromatographie Service GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Dr. Licht GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Dr. Maisch HPLC GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>EURA AG</li> <li>Horizon Microtechnologies GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ISERA GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Macherey-Nagel GmbH & Co. KG</li> <li>Nanoscribe GmbH & Co. KG</li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> <li>Sykam Chromatographie Vertriebs GmbH <span style="color:#0064a5; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Tosoh Bioscience GmbH</li> <li>YMC Europe GmbH</li> </ul>
<p>An der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten beteiligt sich bisher die Tosoh Bioscience GmbH. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22786N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 524.055 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1445">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2018">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 06/2025]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 26.09.2024 (Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e. V.)<br /> - 04.05.2023 (Webkonferenz)<br /> - 07.02.2023 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%203DmiChrom" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket 3DmiChrom" abonnieren.</strong></p> |
|
InTherSteLa
Innovative Therapie der Spinalkanalstenose mittels Laserablation unter OCT-Kontrolle
|
(2022-2025)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
3D-Visualisierung, Monitoring4
|
Laufende Projekte |
<p>Die häufig auftretende Verengung des Wirbelkanals, die Spinalkanalstenose, wird in einer anspruchsvollen Operation behoben, bei der es durch den Einsatz unspezifischer Fräsen zur Verletzung darunterliegender Gewebe mit weiteren Komplikationen kommen kann. Im Projekt soll ein flexibles Handstück entwickelt werden, das einen hochpräzisen Knochenabtrag ohne Gefährdung tiefer liegender Gewebeschichten ermöglicht. Dies soll durch Einsatz und Verbindung zweier Technologien erreicht werden, nämlich der Knochenablation durch einen medizinischen Laser bei einer Live-Vorausschau mittels Optischer Kohärenztomographie (OCT).</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22642N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Laser Zentrum Hannover e. V.</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>Asklepios Kliniken Hamburg GmbH</li> <li>FiberBridge Photonics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LASEROPTIK GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LIMA Photonics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Fotonir ApS</li> <li>Pantec Biosolutions AG</li> <li>Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>Quazar Software GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>RIWOspine GmbH</li> <li>Sill Optics GmbH</li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> <li>TEM Messtechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligen sich bisher die Unternehmen LO Laseroptik GmbH, Pantec Biosolutions AG, Qioptiq Photonics GmbH & CO. KG, Richard Wolf GmbH für das Tochterunternehmen RIWOSpine und Sill Optics GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben 01IF22642N der F.O.M. wird über die AiF im Rahmen des Förderprogramms Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund einer Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 249.832 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1386">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2096">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 02/2025]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundenen PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 23.04.2024 (Webkonferenz)<br /> - 25.09.2023 (Hybridveranstaltung)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20InTherSteLa" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket InTherSteLa" abonnieren.</strong></p> |
|
TransCeram
Hochtransparente und mechanisch höchst beanspruchbare Keramiken – Qualitätssprung durch neues Herstellungsverfahren
|
(2022-2024)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Detektion, Diagnostik5
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Hochtechnologie Materialien8
|
Laufende Projekte |
<p>Die derzeitige Herstellung von Transparentkeramiken aus kristallinen Pulvern erfordert diverse zeit- und energieaufwendige sowie kostenintensive Prozessschritte zur defektvermeidenden Formgebung und Sinterverdichtung. Das Projektziel von TransCeram war die Entwicklung eines innovativen Herstellungsverfahrens zur vereinfachten maßgeschneiderten Produktion hochtransparenter und mechanisch höchst beanspruchbarer nanokristalliner Keramiken, z. B. für medizintechnische oder aeronautische Anwendungen. Das Verfahren sollte auf der Hochdruckkristallisation aus Gläsern häufig vorkommender Geomaterialien beruhen.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22506N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Institut für Geowissenschaften,<br /> Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</li> <li>Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Dresden</li> <li>Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>Aachener Quarzglas-Technologie Heinrich GmbH &<br /> Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ASML Berlin GmbH</li> <li>asphericon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG</li> <li>CRYSTAL GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>dopa diamond tools GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>FISBA AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>II-VI GmbH</li> <li>INGENERIC GmbH</li> <li>joimax GmbH</li> <li>KARL STORZ SE & Co. KG</li> <li>Korth Kristalle GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LAYERTEC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Olympus Winter & Ibe GmbH</li> <li>Sasol Germany GmbH</li> <li>SCHOTT AG</li> <li>Schröder Spezialglas GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SPECTARIS e. V. <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>Verband</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligen sich bisher die Unternehmen ASML Berlin GmbH, asphericon GmbH, Coherent LaserSystems GmbH & CO. KG, FISBA AG, INGENERIC GmbH, KARL STORZ SE & Co. KG, Korth Kristalle GmbH, LAYERTEC GmbH, Olympus Winter & Ibe GmbH und Schröder Spezialglas GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22506N der F.O.M. wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 647.576 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1309" title="TransCeram">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=1948">Projektplan</a> </li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 06/2025</em>]</li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 21.11.2024 (Christian-Albrechts-Universität, Kiev)<br /> - 11.09.2024 (Virtuelle Sitzung)<br /> - 19.03.2024 (Virtuelle Sitzung)<br /> - 19.10.2023 (Fraunhofer ISC, Würzburg)<br /> - 15.03.2023 (virtuelle Sitzung)<br /> - 27.10.2022 (Fraunhofer IKTS, Dresden)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023<br /> - Zwischenbericht für 2022</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20TransCeram" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket TransCeram" abonnieren.</strong></p> |
|
NanoSpeck3D
Nanoskopie mit wiederholbaren Speckle-Mustern zur 3D-Rekonstruktion
|
(2022-2024)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Laufende Projekte |
<p>Eine schnelle und Nanometer-genaue 3D Darstellung lebender Zellen oder größerer Organismen ist derzeit mit keiner fluoreszenzbasierten hochauflösenden Mikroskopietechnik möglich. Ziel von NanoSpeck3D war, ein kostengünstiges Mikroskopiemodul für eine Intravitalmikroskopie mit < 50 nm lateraler, < 100 nm axialer sowie mit einer zeitlichen Auflösung von 1 Sekunde in einem ausgedehnten Volumen zu entwickeln. Grundlage sollte die strukturierte Beleuchtung der Probe mit mehreren und wiederholbaren überlagerten statistischen Mustern (Speckles) verschiedener Wellenlänge sowie die nichtlineare Antwort der Fluorophore sein.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22462N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li> <p>Institut für Angewandte Optik und Biophysik (IAOB), Universität Jena</p> </li> <li>Sektion Translationale Neuroimmunologie, Universitätsklinikum Jena</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>asphericon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>ATTO-TEC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>Carl Zeiss AG</li> <li>Carl Zeiss Microscopy GmbH</li> <li>GATTAquant GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>GRINTECH GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>HOLOEYE Photonics AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>JENOPTIK AG</li> <li>Lasertack GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>LASOS Lasertechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>LAYERTEC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>Optics Balzers Jena GmbH</li> <li>piezosystem jena GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>POG Präzisionsoptik Gera GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> <li>Sartorius Automated Lab Solutions GmbH</li> <li>Wienecke & Sinske GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><sup>KMU</sup></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligen sich bisher die Unternehmen ALS Automated Lab Solution GmbH, asphericon GmbH, ATTO-TEC GmbH, GRINTECH GmbH, JENOPTIK AG, LAYERTEC GMbH sowie POG Präzisionsoptik Gera GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22462N der F.O.M. wird im Rahmen des Förderprogramms Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 448.779 EUR</li> </ul><p> <strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1392" title="NanoSpeck3D">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2048">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li>S. Weiler, V. Rahmati, M. Isstas, J. Wutzke, A. W. Stark, C. Franke, C. Geis, O. W. Witte, M. Hübener, J. Bolz, T. W. Margrie, K. Holthoff, M. Teichert, A primary sensory cortical interareel feedforward inhibitory circuit for tacto-visual integration. bioRxiv. DOI:<a href="https://doi.org/10.1101/2022.11.04.515161">10.1101/2022.11.04.515161</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 06/2024]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 24.04.2025 (Webkonferenz)<br /> - 12.12.2023/22.01.2024 (Webkonferenzen)<br /> - 25.10.2022 (Präsenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023<br /> - Zwischenbericht für 2022</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20NanoSpeck3D" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket NanoSpeck3D" abonnieren.</strong></p> |
|
Rio sio
Robotische Inspektion von Unvollkommenheiten in optischen Oberflächen
|
(2022-2024)
|
F.O.M.
|
|
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Laufende Projekte |
<p>Bei der Unterscheidung von Oberflächenfehlern und Verschmutzungen, insbesondere bei Hochleistungsoptiken, sind fehlerhafte Bewertungen für eine korrekte Klassifikation der Bauteilgüte kritisch. Das Projektziel war, einen reproduzierbaren sowie nutzerunabhängigen Bewertungsprozess zu schaffen, der eine sichere Unterscheidung von Fehlern und Verschmutzungen ermöglicht. Dies sollte durch ein vollständig automatisiertes robotisches System mit einem geschlossenen Reinigungs und Bewertungskreislauf erreicht werden, das für komplexe Freiformflächen mit bspw. 100 mm Durchmesser aber auch für Mikrolinsen einsetzbar ist.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22263N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Technische Hochschule Deggendorf THD, Institut für Präzisionsbearbeitung und Hochfrequenztechnik</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>AIXEMTEC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>asphericon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>FISBA AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>GD Optical Competence GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>HOFBAUER Optik Mess- & Prüftechnik <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>KARL STORZ SE & Co. KG</li> <li>LASER COMPONENTS Germany GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Mitsubishi Electric Europe B. V.</li> <li>POG Präzisionsoptik Gera GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SIOS Meßtechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Sonosys Ultraschallsysteme GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SwissOptic AG</li> <li>Zollner Elektronik AG</li> </ul>
<p>Von den Unternehmen beteiligen sich bisher die Unternehmen asphericon GmbH, FISBA AG, GD Optical Competence GmbH, KARL STORZ SE & Co. KG, LASER COMPONENTS Germany GmbH, POG Präzisionsoptik Gera GmbH, SIOS Meßtechnik GmbH und SwissOptic AG an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben 01IF22263N der F.O.M. wird im Rahmen des Förderprogramms Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund einer Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 246.013 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1237" title="Rio sio">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2004">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 12/2024]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundenen PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 16.12.2024 (TH Deggendorf, Teisnach)<br /> - 18.12.2023 (TH Deggendorf, Teisnach)<br /> - 25.10.2022 (TH Deggendorf, Teisnach)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023<br /> - Zwischenbericht für 2022</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20Rio-sio" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket Rio sio" abonnieren.</strong></p>
<ul> </ul> |
|
OrganOiCT
Axial registrierte OCT für die in-vitro-Darstellung von großen 3D-Zellkulturen
|
(2022-2024)
|
M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
3D-Visualisierung, Monitoring4
Sonstige Metathemen13
|
Laufende Projekte |
<p>3D-Zellkulturen stellen eine realitätsnähere Alternative zu klassischen 2D-Zellkulturen dar, allerdings ist ihre Visualisierung bisher zeitaufwändig und zerstörend. Projektziel war, die optische Kohärenztomographie (OCT) als nichtinvasive und schnelle Alternative für die Bildgebung von 3D-Zellkulturen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm weiterzuentwickeln. Hierzu sollte eine Messbereichsverdoppelung durch zu parallelisierende Messungen eines OCT-Systems mit zwei separaten Messarmen erfolgen. Ein Algorithmus sollte beide Datensätze zu einem großen Volumendatensatz zusammenführen und die Messzeit minimieren.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22477N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li> <p>Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT</p> </li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>arrows biomedical Deutschland GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>BellaSeno GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Cellendes GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>DITABIS AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>faCellitate GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Life & Brain GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LLS Rowiak GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Matricel GmbH</li> <li>npi electronic GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Technische Universität Darmstadt</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligen sich bisher die beiden Unternehmen arrows biomedical Deutschland GmbH sowie LLS Rowiak LaserLabSolutions GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK- Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22477N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 238.888 EUR</li> </ul>
<p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1301">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=1946">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li>Hachgenei E, Vakaeva M, Schmitt RH. Diametrical optical coherence tomography for extended depth measurement range. <em>tm - Technisches Messen,</em> <strong>2023</strong>; 90:67-72; <a href="https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/teme-2023-0072/html">DOI: 10.1515/teme-2023-0072</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote [<em>Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 08/2024]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 09.12.2024 (Fraunhofer IPT, Aachen)<br /> - 03.08.2023 (Webkonferenz)<br /> - 09.02.2023 (Webkonferenz)<br /> - 04.08.2022 (Fraunhofer IPT, Aachen)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023<br /> - Zwischenbericht für 2022</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20OrganOiCT" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket OrganOiCT" abonnieren.</strong></p>
|
|
OptiMassKI
Hybride KI für die Prozessoptimierung in der Serienfertigung von komplexen Optiken
|
(2022-2024)
|
F.O.M.
|
|
3D-Visualisierung, Monitoring4
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Künstl. Intelligenz, Deep Learning11
Sonstige Metathemen13
|
Laufende Projekte |
<p>In der Glasumformung führen nicht optimale Temperaturen in Heizraum und Glas zu Formfehlern und Defekten, doch die Temperaturverteilungen lassen sich durch Sensorik schwer erfassen. Die alternative Nutzung von Machine Learning Modellen benötigt ausgebildete Data Scientists – oder wenn automatisiert – Unmengen an Daten. Ziel dieses Projektes war die Prozessoptimierung durch Vorhersage des Glas-Fließverhaltens mithilfe hybrider künstlicher Intelligenz. Dazu sollte ein Machine Learning Modell mit Sensordaten trainiert, mit rheologischen Modellen kombiniert und in bedienungsfreundliche Software implementiert werden.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22461N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für<br /> Produktionstechnologie IPT, Aachen</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>AIXEMTEC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Anton Paar Germany GmbH</li> <li>EDI GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>First Glass Optics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Gauss Machine Learning GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>INGENERIC GmbH</li> <li>Moulded Optics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>son-x GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Vitrum Technologies GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>WALTEC Maschinen GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligen sich die Unternehmen INGENERIC GmbH, son-x GmbH, Vitrum Technologies GmbH und WALTEC Maschinen GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der beteiligten Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22461N der F.O.M. wird im Rahmen des Förderprogramms Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 274.684 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1704">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=1939">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote <em>[Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 06/2025]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 12.12.2024 (Webkonferenz)<br /> - 10.09.2024 (Webkonferenz)<br /> - 14.03.2024 (Webkonferenz)<br /> - 01.03.2023 (Webkonferenz)<br /> - 30.06.2022 (Fraunhofer IPT, Aachen)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023<br /> - Zwischenbericht für 2022</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20OptiMassKI" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket OptiMassKI" abonnieren.</strong></p> |
|
MATCH
Marker-unabhängige Analyse von im Blut zirkulierenden Tumorzellen in einem miniaturisierten und modularen Hydrosystem
|
(2022-2025)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Detektion, Diagnostik5
|
Laufende Projekte |
<p>Die Analyse von im Blut zirkulierenden Tumorzellen (CTC) kann entscheidende Informationen über die Prognose oder das Therapieansprechen von Krebspatienten liefern. Die aktuell verwendeten Marker zur Detektion und Analyse von CTCs erfassen jedoch nur bestimmte CTC-Subpopulationen, während andere nicht entdeckt werden. Das Projektziel von MATCH ist die Entwicklung eines Systems zur Marker-unabhängigen und zerstörungsfreien CTC-Analyse, welches das gesamte Spektrum an CTCs erfasst. Dies soll durch die Kombination von Mikrofluidik-, Transfer- und Raman-Spektroskopie-Modulen erreicht werden.</p>
<p>IGF-Projekt: 01IF22401N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT St. Augustin</li> <li>Univ. Lübeck u. Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck</li> <li>Hochschule Hamm-Lippstadt HSHL</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>adesso SE</li> <li>arrows biomedical Deutschland GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Bartels Mikrotechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Ferber-Software GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>JÜKE Systemtechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Kanano GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Laser 2000 GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LASOS Lasertechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Localite GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>microfluidic ChipShop GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Nanosurf GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Professur am Institut für Klinische Pharmakologie, Goethe-Universität Frankfurt/Main</li> <li>Quantum Design GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>RWTH Aachen, Lehrstuhl für Biotechnologie</li> <li>Sartorius Automated Lab Solutions GmbH</li> <li>ysura GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligen sich bisher die Unternehmen ALS Automated Lab Solutions GmbH, arrows biomedical Deutschland GmbH sowie die JÜKE Systemtechnik GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22401N der F.O.M. wird im Rahmen des Förderprogramms Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 737.593 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1221" title="MATCH">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2003">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote [<em>Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 07/2024]</em></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 09.12.2024 (Webkonferenz)<br /> - 07.12.2023 (Webkonferenz)<br /> - 30.06.2022 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023<br /> - Zwischenbericht für 2022</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022</li> </ul>
<p><strong>Als F.O.M.-Mitglied können Sie über eine formlose <a href="mailto:info@forschung-fom.de?subject=Abonnierung%20des%20Ergebnis-Paketes%20MATCH" title="Opens window for sending email">E-Mail</a> das entsprechende "Ergebnis-Paket MATCH" abonnieren.</strong></p> |
|
MacroGlass
Kombinationsprozess zur laserbasierten Herstellung von makroskopischen 3D-Glasbauteilen mit mikroskopischen Strukturgrößen
|
(2022-2024)
|
F.O.
|
|
Hochtechnologie Materialien8
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Sonstige Metathemen13
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 01IF22034N (2022 - 2024)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>3D-Glasbauteile werden in vielen Branchen, beispielsweise in der Optik, Mikroelektronik, Medizintechnik und Quantentechnologie, eingesetzt. Aufgrund der hohen Präzisionsanforderungen an diese Bauteile ist deren Herstellung derzeit meist aufwendig und somit kostenintensiv. Das Selektive Laser-induzierte Ätzen (SLE) ist ein kontaktloses Verfahren zur verschleißfreien Produktion von 3D-Glasbauteilen mit nahezu beliebigen, komplexen Geometrien, auch mit Hinterschnitten. Zur Anlage von Mikrostrukturen innerhalb des Glassubstrats wird dieses mit Ultrakurzpuls (UKP)-Lasern hoher Intensität modifiziert. Die Energie wird durch Absorptionseffekte im Fokusbereich des Lasers deponiert. Hierzu wurden bisher eine starke Fokussierung mit Mikroskopobjektiven genutzt ("Mikro-SLE-Prozess"). Dies führte jedoch bisher zu einem kleinen Scanfeld, einer geringen Vorschubgeschwindigkeit und zur Erfordernis vieler Zustellvorgänge, was den Mikro-SLE-Prozess zeit- und kostenintensiv machte. Zudem war die maximale Glasbauteil-Dicke aufgrund des geringen Arbeitsabstands auf 14 mm begrenzt.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel war die Weiterentwicklung des Mikro-SLE-Verfahrens für eine signifikant schnellere Herstellung mikrostrukturierter 3D-Glasbauteile und die Verschiebung bisheriger Abmessungsgrenzen. Zur Beibehaltung der Mikrometer-Präzision des Verfahrens bei der Herstellung makroskopischer Bauteile sollte ein Grobbearbeitungsprozess ("Makro-SLE-Prozess") entwickelt und mit einem nachfolgenden Mikro-SLE-Prozess kombiniert werden. Durch längere Brennweiten des Makro-SLEs und die resultierenden größeren Scanfelder sollten die Vorschubgeschwindigkeit erhöht werden. Gleichzeitig sollte ein größerer Arbeitsabstand erreicht werden und weniger Zustellvorgänge notwendig sein. Die Rauheiten sollten durch den anschließenden lokalen Mikro-SLE-Prozess reduziert werden. Durch das Kombinationsverfahren sollte sich die Produktionsgeschwindigkeit um einen Faktor > 10 beschleunigen, bei Selektivitäten > 1000. Das Verfahren sollte Abmessungen der 3D-Glasbauteile bis über 5 cm erlauben und an geforderten Stellen Präzisionen mit Toleranzen von ≤ 2 μm ermöglichen.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Zunächst wurde der Makro-SLE-Prozess zur Fertigung von makroskopischen 3D-Glasbauteilen erfolgreich entwickelt und von den Prozessgrundlagen bis hin zur Anlagentechnik aufgebaut. Mit diesem Verfahren konnte aus einem planen Glasblock ein strukturiertes 3D-Glasbauteil mit einer Bauteiltiefe von 10 mm und mit integrierten Kanälen heraus-geätzt werden. Die Prozessgeschwindig-keit konnte bei dieser einfachen Bauteil-geometrie um einen Faktor 42 im Vergleich zum Mikro-SLE-Prozess erhöht werden. Bei komplexeren Geometrien werden noch größere Steigerungen der Prozessgeschwindigkeit erwartet.<br /> <br /> Mit dem Makro-SLE-Prozess gelang die Fertigung von 3D-Demonstratoren mit Bauteiltiefen von 50 mm und mit inte-grierten Kanälen innerhalb eines breiten Prozessfensters an Fertigungsparame-tern, mit Selektivitäten > 1000. Die Kanalstrukturen wiesen allerdings im Vergleich zu mit dem Mikro-SLE-Prozess gefertigten Strukturen sehr hohe Oberflächenrauheiten auf, die auf das hohe Streckungsverhältnis des Fokusvolumens zurückzuführen sind. Die Rauheiten der herausgeätzten Flächen parallel zur lan-gen Halbachse des Fokusvolumens sind deutlich geringer als die der Flächen or-thogonal zur langen Halbachse. Bei unterschiedlichen Oberflächenansprüchen an verschieden orientierte Flächen kön-nen somit auf relevanten Flächen geringere Rauheiten durch eine entsprechende Optimierung der Ausrichtung erzielt werden.<br /> <br /> Zur gezielten lokalen Erhöhung der Präzision wurden Makro- und Mikro-SLE-Prozesse miteinander kombiniert. Hierfür konnten mit dem Makro-SLE-Prozess hergestellte Bauteile mit geringer Bauteiltiefe erfolgreich auf die Anlagentechnik des Mikro-SLE-Prozesses transferiert werden. An 3D-Glasbauteilen mit Abmessungen bis zu 10 mm wurde so die Rauheit in den Kanälen auf die Qualitätsstufe des Mikro-SLE-Prozesses reduziert.<br /> <br /> Das Projektziel der Entwicklung eines erweiterten SLE-Kombinationsverfahrens zur beschleunigten Fertigung strukturierter 3D-Glasbauteile hoher Präzision wurde somit für geringe Bauteiltiefen, bis maximal 14 mm, mit hoher Selektivität vollständig erreicht. 3D-Glasbauteile mit Abmessungen bis über 5 cm können mit dem Kombinationsverfahren ebenfalls gefertigt werden, hohe lokale Präzisionen sind jedoch auf den Bereich einer Bauteiltiefe bis zu 14 mm beschränkt.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Die Projektergebnisse ermöglichen Unternehmen der mittelständisch geprägten Photonik-Branche, mit hoher Pro-duktivität 3D-Glasbauteile mit einer Bauteiltiefe bis über 5 cm und hoher lokaler Präzision herzustellen. Mit der um den Faktor > 42 höheren Prozessgeschwindigkeit im Vergleich zum Mikro-SLE-Prozess lassen sich zudem die Maschinenkosten schneller amortisieren. Da die Prozessführung der SLE-Prozesse mit kommerziell verfügbarer Systemtechnik aufgebaut ist und ein uneingeschränktes Nutzungsrecht zur Verwendung der SLE-Verfahren besteht, wird KMU, die oft durch geringere Ressourcen für neue Investitionen beschränkt sind, ein einfacher Zugang ermöglicht. Zudem wird die zu verwendende Systemtechnik vor allem von KMU bereitgestellt, deren Position dadurch am Markt gestärkt wird.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen </li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>Amplitude Systèmes <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ASML Berlin GmbH</li> <li> <p>Carl Zeiss Jena GmbH</p> </li> <li> <p>Carl Zeiss SMT GmbH</p> </li> <li>EdgeWave GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>FISBA AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>MDI Advanced Processing GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG</li> <li>Pulsar Photonics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SCANLAB GmbH</li> <li>SCHOTT AG</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligen sich bisher die Unternehmen ASML Berlin GmbH, Carl Zeiss Jena GmbH, Carl Zeiss SMT GmbH, EdgeWave GmbH, FISBA AG, MDI Advanced Processing GmbH sowie die SCANLAB GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 01IF22034N der F.O.M. wurde im Rahmen des Förderprogramms Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 225.587 EUR</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=2220"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 04.07.2024 (Fraunhofer ILT, Aachen)<br /> - 07.03.2024 (Webkonferenz)<br /> - 23.02.2023 (Webkonferenz)<br /> - 30.08.2022 (Fraunhofer ILT, Aachen)<br /> - 11.03.2022 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023<br /> - Zwischenbericht für 2022</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022</li> </ul> |
|
ReMultiMi
Replikative Herstellung multifunktionaler Mikrofluidikfolien
|
(2021-2023)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Oberflächen-Funktionalisierung7
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>Im Life-Science-Bereich erfordern steigende Anforderungen an die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit von Lab-on-Chip-Systemen neue Werkzeuge für die Abformung von Polymerfolien mit ortsselektiv funktionalisierten Oberflächen. Projektziel war, die Multifunktionalität der Folien – unabhängig von ihrer chemischen Zusammensetzung – durch eine laserbasierte Mikro- und Nanostrukturierung der Replikationswerkzeug-Oberflächen zu erreichen, um z. B. hydrophile und hydrophobe Eigenschaften effizient einstellen zu können. Dazu sollten einstufige Verfahren mittels Direktem Laser- und Laserinterferenzstrukturieren entwickelt werden.</p>
<p>IGF-Projekt: 21934 BR</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, Chemnitz</li> <li>Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>ACSYS Lastertechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Bio-Gate AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Coherent Kaiserslautern GmbH</li> <li>Fischer Werkzeugbau GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Fusion Bionic GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>GBS mbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Gebrüder Ficker GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ibidi GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>neoLase <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>OPTOGON GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Pulsar Photonics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SensLab GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SilkoTek GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SITEC Industrietechn. GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Vorwerk Nickern GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>WZB Hartmann GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>WESKO GmbH</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligen sich bisher die Unternehmen ACSYS Lasertechnik, Bio-Gate AG, GBS mbH, SensLab und WZB Hartmann an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 21934 BR der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 431.668 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1208" title="ReMultiMi">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=1359">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote [<em>Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 03/2024</em>]</li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 19.12.2023 (Webkonferenz)<br /> - 07.06.2023 (Webkonferenz)<br /> - 02.11.2022 (Webkonferenz)<br /> - 09.03.2022 (Webkonferenz)<br /> - 02.09.2021 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2023<br /> - Zwischenbericht für 2022<br /> - Zwischenbericht für 2021</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2024<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021</li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 13. Juni 2024 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
HoloScope
Nadelförmiges linsenloses holografisches Endoskop
|
(2021-2024)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Detektion, Diagnostik5
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 21802 BG (2021 - 2024)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Die Anwendung optischer Methoden in der medizinischen Diagnostik und in der industriellen Fertigungs- und Prozessmesstechnik ist zurzeit fast ausschließlich auf frei zugängliche Strukturen beschränkt. Für schwer zugängliche oder innenliegende Bereiche können zwar flexible Endoskope eingesetzt werden, diese müssen allerdings aufwendig für jeden Anwendungsbereich entwickelt werden. Sollen die Endoskope dünn (insbesondere für minimal-invasive Einsätze) sein, ist bisher nur eine 2D-Bildgebung möglich. Eine 3D-Bildgebung ist bisher nur mit Endoskopen mit einem Durchmesser von mehreren Millimetern möglich. Viele innovative Anwendungen, beispielsweise in der dimensionellen Messtechnik und bei minimal-invasiven medizinischen Eingriffen, wie die Einbringung von Cochlea-Implantaten im Innenohr oder die in-vivo-Tumordiagnostik, erfordern jedoch kleinere Durchmesser im Sub-Millimeter-Bereich und eine 3D-Bildgebung mit hinreichender räumlicher Auflösung von einigen Mikrometern. Viele medizinische Eingriffe werden daher zurzeit noch ohne unterstützende Bildgebung durchgeführt.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des Projekts HoloScope war die Entwicklung eines Demonstrators eines kostengünstigen und flexibel einsetzbaren linsenlosen Endoskops mit einem Durchmesser unter 0,5 mm, welches zur 3D-Bildgebung mit Auflösungen im 1-μm-Bereich verwendet werden kann. Hierzu sollten neuartige und fortschrittliche optische Faserbündel für die robuste Übertragung vollständiger 3D-Lichtinformationen, d. h. Betrag und Phase des elektromagnetischen Lichtfeldes, entwickelt werden. Da die komplexe Übertragungsfunktion des Faserbündels die zu übertragenden 3D-Informationen überlagert, müssen die dynamischen Phasenstörungen im Endoskop robust, schnell und präzise holografisch vermessen und beispielsweise durch den Einsatz elektro-optischer Elemente (Flächenlichtmodulatoren) oder numerisch kompensiert werden. Leistungsfähige und echtzeitfähige Konzepte zur dynamischen Kalibrierung des Endoskops sollten erforscht und kombiniert werden. Vielfältige Anwendungspotenziale lägen zum Beispiel in der Medizintechnik und der Fertigungsmesstechnik.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>In dem Projekt konnte zur Herstellung maßgeschneiderter Faserbündel ein skalierbarer Fertigungsprozess erfolgreich entwickelt werden. Dieser basiert auf einem mehrstufigen Prozess, bei dem ein Bündel aus Glasstäben zu einer Faser bzw. einem Faserbündel ausgezogen wird. Dieser Vorgang des „Bündelns und Ausziehens“ (engl. stack and draw) wird iterativ durchgeführt. Die finale Faser hat einen Durchmesser von 450 μm und führt in bis zu 1.800 individuellen Kernen das Licht verlustarm auf mehreren Metern Länge.<br /> <br /> Parallel wurde ein Verfahren entwickelt, um ein diffraktives optisches Element (DOE) mittels Zwei-Photonen-Polymerisation – einem generativen Verfahren im Nanometerpräzisionsbereich – direkt auf die Faserfacette aufzudrucken. Durch diesen Ansatz können zwei Herausforderungen zugleich gelöst werden:<br /> <br /> 1) Die inhärenten Phasenstörungen der individuellen Faserkerne können korrigiert werden, sodass die statische Übertragungsfunktion des Faserbündels vollständig kompensiert wird.<br /> <br /> 2) Durch ein Profil im DOE aus konzentrischen Ringen unterschiedlicher Höhe wird die Übertragungsfunktion der einer Linse angenähert, sodass hinter der Faser ein Fokus entsteht und die Faser als ultradünne Linse genutzt werden kann.<br /> <br /> Zudem konnte durch eine Verdrillung des Faserbündels eine Unabhängigkeit der optischen Übertragungsfunktion bezüglich des dynamischen Deformationszustands der Faser erreicht werden. Das finale Resultat ist eine ultradünne (minimal-invasive) und dynamisch verformbare faseroptische Linse für die 3D-Bildgebung in der Endoskopie.<br /> <br /> Im Projekt konnte eine 3D-Bildgebung mit einer Wiederholrate von 20 2D-Bildern/Sekunde (150 x 150 x 600 μm3/Sek) demonstriert werden. Zudem wurde lateral eine Auflösung von ca. 1 μm sowohl für die Weitfeldbildgebung als auch für Raster-Scan-Aufnahmen erreicht.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Das entwickelte ultradünne linsenlose Endoskop kann in verschiedenen Bereichen genutzt werden: Es kann z. B. bei minimalinvasiven medizinischen Verfahren durch detaillierte Bilder die Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten verbessern. In der industriellen Fertigung kann es einerseits zur Inspektion und Qualitätskontrolle von schwer zugänglichen oder komplexen Bauteilen eingesetzt werden. Anderseits ermöglicht es in der Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen eine detaillierte Untersuchung ohne Demontage, wodurch Zeit und Kosten eingespart werden können.<br /> <br /> Da der entwickelte Herstellungsprozess leicht skalierbar ist, wird eine wirtschaftliche Herstellung der Fasern in großen Stückzahlen ermöglicht. Als Resultat wird die mittelständisch geprägte Photonik- und Medizintechnik-Branche gestärkt, da sich neue Geschäftsmöglichkeiten und Einnahmequellen ergeben.<br /> <br /> Weiterhin bieten das entwickelte Messverfahren und die Korrekturmöglichkeit der Kern-zu-Kern-Dispersion die Möglichkeit, Dienstleistungen im Bereich der Faseroptik anzubieten, die zumeist von KMU durchgeführt werden.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Technische Universität Dresden</li> <li>Institut für Quantenoptik / Hannover Institute of Technology (HITec),<br /> Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li> <p>ASML Berlin GmbH</p> </li> <li> <p>Carl Zeiss Meditec AG</p> </li> <li>CeramOptec GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Deutsches Hörzentrum Hannover</li> <li>FiberBridge Photonics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>FiberWare GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Forth Dimension Displays Ltd.</li> <li>Holoeye Photonics AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH</li> <li>LASER COMPONENTS Germany GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LLS ROWIAK LaserLabSolutions GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Multiphoton Optics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Sikora GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden</li> <li>WEINERT Fiber Optics GmbH</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligen sich bisher die Unternehmen ASML Berlin GmbH, Carl Zeiss Meditec AG, CeramOptec GmbH, FiberWare GmbH, JENOPTIK Industrial Metrology GmbH, LASER COMPONENTS Germany GmbH und Sikora AG an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 21802 BG der F.O.M. wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 463.325 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li>Stephan, R., Scharf, E., Zolnacz, K., Urbanczyk, W., Hausmann, K., Ließmann, M., Gürtler, J., Glosemeyer, T., Czarske, J., Steinke, M., Kuschmierz, R., Bendable Fiber Lens for Minimally Invasive Endoscopy.<em> Laser Photonics Rev.</em> <strong>2025</strong>, 2401757. DOI: <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/lpor.202401757">10.1002/lpor.202401757</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=2190"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 25.05.2021 (Webkonferenz)<br /> - 02.12.2021 (Webkonferenz)<br /> - 22.06.2022 (HITec, Leibniz Universität Hannover)<br /> - 28.11.2022 (TU Dresden)<br /> - 24.05.2023 (Webkonferenz)<br /> - 11.12.2023 (Webkonferenz)<br /> - 13.03.2024 (HITec, Leibniz Universität Hannover)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2022<br /> - Zwischenbericht für 2021</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021</li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 13. Juni 2024 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
Laser Beam Figuring
Entwicklung eines laserbasierten Korrekturpoliturverfahrens für Asphären und Freiformoptiken aus Quarzglas und ULE
|
(2021-2023)
|
O.
|
|
Oberflächen-Funktionalisierung7
Sonstige Metathemen13
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 21672 N (2021 - 2023)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Die Bearbeitung der Oberflächen optischer Komponenten erfolgt meist durch Schleifen und Polieren mit immer feiner spanendem Materialabtrag. Dieses die Oberflächenqualität bestimmende Vorgehen wird im Fall von Hochpräzisionsoptiken mit einem korrigierenden, zonal verfahrenden Politurschritt abgeschlossen. Die auf komplex geometrische Optiken (Asphären oder Freiformflächen) angewandte Korrekturpolitur erfordert mit konventionellen Fertigungsmethoden sehr lange Bearbeitungszeiten und verursacht hohe Prozesskosten.<br /> <br /> Aktuelle Ansätze der laserbasierten Bearbeitung optischer Oberflächen versprechen hohe formunabhängige Prozessgeschwindigkeiten und Oberflächenqualitäten. Die Anwendbarkeit eines solchen, auf Materialablation beruhenden Verfahrens nahe der Verdampfungstemperatur zur Korrekturpolitur konnte bereits an planen Oberflächen demonstriert werden. Eine unzureichend zuverlässige Reproduzierbarkeit der Abtragtiefe limitierte den Einsatz des Verfahrens jedoch bisher.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des IGF-Projekts Laser Beam Figuring war die Entwicklung einer schnellen und kostengünstigen laserbasierten Korrekturpolitur für hochpräzise Asphären aus Quarzglas und extrem ausdehnungsarmem, Titan-haltigem Silikatglas (ULE). Um Formfehler, nieder- und mittelfrequente Fehler zu korrigieren, sollte ein gezielter lokaler Glasabtrag um weniger als 100 nm mit einer lateralen Auflösung von ca. 50 µm erreicht werden, ohne dabei eine wesentliche Erhöhung der Rauheit zu erzeugen. Die angestrebte quadratische Mittenrauheit der polierten Fläche sollte im Bereich 0,2–0,4 nm liegen. Erzielt werden sollte dies mithilfe einer stabilen modulierten CO<sub>2</sub>-Laserstrahlung, die Bedingungen nahe der Verdampfungstemperatur des Materials erzeugt, und einer an den Prozess angepassten Anlagentechnik.<br /> <br /> Dieser Prozess sollte auch auf Freiformflächen übertragen werden und durch die Entwicklung einer Software, die ein Skript zur Ansteuerung des Lasersystems erstellt, automatisiert werden, um optimale Oberflächenqualitäten zu erhalten.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Mit dem entwickelten Versuchsaufbau konnte mithilfe der im geregelten Betrieb erzeugten hochstabilen, modulierten CO<sub>2</sub>-Laserstrahlung reproduzierbare Abtragtiefen von weniger als 100 nm mit einer lateralen Auflösung von ca. 50 µm auf planen Quarzglas-Oberflächen erzielt werden. Eine steigende Pulsdauer erhöhte hierbei die Abtragtiefe. Mit einer Repetitionsrate von 8 kHz und einer Pulsdauer von 42 µs konnte eine Abtragsrate <span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">V̇</span></span> bis zu 970 mm<sup>3</sup>/h erreicht werden, die die Rate konventioneller Verfahren (Ion beam figuring: <span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">V̇</span></span> < 10 mm<sup>3</sup>/h, Magneto rheological finishing: <span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">V̇</span></span> < 60 mm<sup>3</sup>/h) übersteigt.<br /> <br /> Nieder- und mittelfrequente Fehler konnten mit dem erprobten Korrekturverfahren erfolgreich korrigiert werden, was mit konventionellen Verfahren nur unter erheblichem Aufwand möglich ist.<br /> <br /> Für die laserbasierte Korrekturpolitur gekrümmter Oberflächen konnte der neigungswinkelabhängige Abtrag über die Pulsdauer kompensiert werden. Die Korrekturpolitur von Asphären ist somit prinzipiell möglich, konnte jedoch aufgrund fehlender geeigneter Proben bisher nicht nachgewiesen werden.<br /> <br /> Bei der Korrekturpolitur von ULE kam es weit unterhalb der Verdampfungstemperatur aufgrund des Titangehalts zu ortsselektiver Ausdehnung des Probenmaterials. Eine laserbasierte Korrekturpolitur von ULE-Bauteilen ist aufgrund des exponentiellen Anstiegs der Abtragtiefe bei vergleichsweise geringer Ausdehnung dennoch grundsätzlich möglich.<br /> <br /> Zudem gelang es, eine Software zu entwickeln, die ein automatisiertes Bearbeitungsprogramm zur Steuerung des Lasersystems für die Korrekturpolitur erstellt, um eine bestmögliche Oberflächengüte zu erhalten. Dies basiert auf dem Vergleich der interferometrischen Messwerte der IST-Oberfläche mit der Beschreibung der SOLL-Oberfläche. So konnte exemplarisch die quadratische Mittenrauheit einer Probe von 0,647 nm auf 0,388 nm reduziert werden.<br /> <br /> Trotz höherer Anlagenanschaffungskosten können mit der laserbasierten Korrekturpolitur unter Berücksichtigung der geringeren Bearbeitungszeit und Personalkosten im Vergleich zu konventionellen Verfahren 90 % der Kosten eingespart werden.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Mit einer Etablierung der laserbasierten Korrekturpolitur in der mittelständisch geprägten Photonik-Industrie können bestehende Prozesse ergänzt und langfristig ersetzt werden, sodass die Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöht und Kosten eingespart werden können. Zudem werden hierbei keine umweltschädlichen und kostenintensiv zu entsorgenden Poliermittel eingesetzt. Durch die Entwicklung einer effizienten Korrektur nieder- und mittelfrequenter Fehler können Linsen mit höheren Oberflächengüten angeboten werden, was die Position der Unternehmen am Weltmarkt stärkt. Perspektivisch können zudem Freiformoptiken laserbasiert korrekturpoliert werden und in der Anwendung mehrere sphärische Linsen ersetzen.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer ILT Aachen</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>asphericon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Carl Zeiss SMT GmbH</li> <li>Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG</li> <li>Innolite GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>JENOPTIK Optical Systems GmbH</li> <li>Karl H. Arnold Maschinenfabrik GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LAYERTEC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Leica Microsystems CMS GmbH</li> <li>LightFab GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SwissOptic AG</li> </ul>
<p>Alle eingebundenen Unternehmen beteiligten sich an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.<br /> </p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 21672 N der F.O.M. wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 248.023 EUR</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Administrationskosten vollständig durch freiwillige Förderbeiträge der Industrieunternehmen des Projektbegleitenden Ausschusses gedeckt</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=2103"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 28.02.2023 (Fraunhofer ILT, Aachen)<br /> - 30.11.2022 (Webkonferenz)<br /> - 25.05.2022 (Webkonferenz)<br /> - 11.11.2021 (Webkonferenz)<br /> - 29.04.2021 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2022<br /> - Zwischenbericht für 2021</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 15. Juni 2023 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
Quant-UV
Quantisierende Nanolaminate für brechwertoptimierte UV-Interferenzfilter
|
(2021-2023)
|
O.
|
|
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Hochtechnologie Materialien8
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>Die aktuell zur Verfügung stehenden Beschichtungsmaterialien für Optiken erlauben im kurzwelligen Bereich nur ein eingeschränktes Eigenschaftenspektrum, insbesondere wenn die Absorptionsverluste möglichst gering und der Brechwert möglichst hoch sein sollen. Projektziel war die Erweiterung des Materialpools für optimierte Beschichtungen für Zukunftstechnologie-Anwendungen im UV-Bereich, z. B. für die Ultrakurzpulsspektroskopie. Dafür sollten verschiedene quantisierende Nanolaminatstrukturen hergestellt und validiert werden, deren Absorption und Brechungsindex sich unabhängig voneinander beeinflussen lassen.</p>
<p>IGF-Projekt: 21364<span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"> </span></span>N</p><p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Laser Zentrum Hannover e. V.</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li> <div class="O0" style="margin-left:18px; text-indent:-.19in; text-align:left">Carl Zeiss SMT GmbH</div> </li> <li>Cutting Edge Coatings GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Evatec AG</li> <li>HÜBNER GmbH & Co. KG</li> <li>InnoLas Laser GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LASER COMPONENTS Germany GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LASEROPTIK GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Optics Balzers Jena GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>robeko GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>UltraFast Innovations GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Alle eingebundenen Unternehmen beteiligen sich an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 21364 N der F.O.M. wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 238.991 EUR</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Administrationskosten vollständig durch freiwillige Förderbeiträge der Industrieunternehmen des Projektbegleitenden Ausschusses gedeckt.</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1296" title="Projektsteckbrief AIxCell">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2044" title="Projektplan Quant-UV">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li>IGF-Erfolgsnote [<em>Bereitstellung nach Projektabschluss, vsl. 06/2024</em>]</li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 12.12.2023 (Webkonferenz)<br /> - 28.11.2022 (Webkonferenz)<br /> - 23.03.2021 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2022<br /> - Zwischenbericht für 2021</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2023<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021</li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 13. Juni 2024 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
AIxCell
Cell Culture Analysis Tool
|
(2020-2022)
|
M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Künstl. Intelligenz, Deep Learning11
Sonstige Metathemen13
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 21361 N (2020 - 2022)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Die zeitaufwendige Analyse biomedizinischer Bilddaten, z. B. in der Zellmikroskopie, wird bisher von spezialisiertem Laborpersonal durchgeführt und ist dementsprechend kostenintensiv. Die Subjektivität der Auswertung und die Anfälligkeit für anwendungs- und gerätespezifische Fehler beeinträchtigen zudem die Vergleichbarkeit der Ergebnisse.<br /> <br /> Methoden des Deep Learning (DL), die tiefe künstliche neuronale Netze zur semantischen Wissensextraktion aus Bilddaten nutzen, ermöglichen eine Hardware-unabhängige automatisierte und objektive Bildauswertung. Die Entwicklung solcher Anwendungen erfordert jedoch Expertise und Erfahrung in den Fachgebieten Datenwissenschaften, maschinelles Lernen, Informationstechnologie und Software-Entwicklung. Über das IT-Knowhow im benötigten Umfang und in ausreichender Tiefe verfügen z. B. Analysen-Spezialisten oder Mediziner nur selten, um funktionsfähige DL-Anwendungen für ihre jeweiligen konkreten Problemstellungen selbst entwickeln zu können. Die Entwicklung spezifischer Einzellösungen bei externen IT-Büros in Auftrag zu geben, ist aus wirtschaftlichen Gründen oft nicht umsetzbar.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des Projekts war, eine intuitiv nutzbare Software zur ganzheitlichen DL-basierten Bildauswertung zu entwickeln, inklusive automatisierter Vorverarbeitung der Daten, Algorithmus-Auswahl und Konfiguration von DL-Modellen, die biomedizinische Experten für verschiedene Zell- und Gewebeanalysen auch ohne umfangreiche IT-Kenntnisse eigenständig nutzen können. Hierzu sollte mithilfe einer domänenspezifischen selbstlernenden Entscheidungslogik (engl. Automated Machine Learning; AutoML) die Konfiguration einer aus Datenvorverarbeitung, neuronaler Netzarchitektur, Lernalgorithmus und Nachbearbeitung bestehenden Datenpipeline für die zur Verfügung stehenden Rechenressourcen und den spezifischen Anwendungsfall optimiert werden. Die Datenpipeline soll im Anschluss trainiert und dem biomedizinischen Experten zur Nutzung und Integration in dessen Analyse-Workflow zur Verfügung gestellt werden.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Um den komplexen und iterativen Entwicklungsprozess einer Datenpipeline zu automatisieren, wurde ein domänenspezifisches AutoML-System basierend aufsemantischer Segmentierung von Mikroskopiedaten entwickelt. Die dazu benötigte modulare Softwarebibliothek, Daten- und Wissensbasis wurden anhand von zehn verschiedenen Anwendungsfällen aufgebaut.<br /> <br /> Das finale AutoML-System besteht aus fünf zentralen Komponenten: 1) Ein vordefinierter Suchraum, 2) eine Wissensbasis aus Metadaten zu den Merkmalen der Anwendungsfälle und der Modell-Performance, 3) eine Datenvorverarbeitung zur Erschließung des maximal extrahierbaren Informationsgehalts, 4) ein Meta-Learning-Modell zur Bestimmung einer Rangfolge der Datenpipelines im Hinblick auf ihre Eignung für die Bearbeitung der Analyseaufgabe und 5) ein Multi-Fidelity-Ansatz zur Identifizierung der am besten performenden Datenpipeline.<br /> <br /> Das AutoML-System wurde in eine lokal nutzbare und in eine Cloud-basierte Anwendung integriert. Bei letzterer kann über einen Internetbrowser eine neue Analyseaufgabe definiert, Daten hochgeladen, diese annotiert und das AutoML-System gestartet werden. Ausgegeben werden die Konfiguration der optimalen Datenpipeline und eine Bewertung der Auswahl. Das Modell kann nun in der Laborumgebung direkt zur Zellkulturanalyse genutzt oder in einen automatisierten Analyse-Workflow integriert werden.<br /> <br /> Die Performance der durch das AutoML-System für verschiedene spezielle Anwendungsfälle konfigurierten Datenpipelines liegt nahe bei individuell entwickelten Modellen und bestätigt damit die Funktionalität des Ansatzes einer vollständigen Automatisierung der DL-Entwicklung und Bildauswertung in abgegrenzten Domänen, ohne gravierende Nachteile in den Modellgenauigkeiten.<br /> <br /> Aktuell erfordern einige Analysen spezifische Nachbearbeitungsschritte, mithilfe derer die Segmentationsmasken der neuronalen Netze auf z. B. morphologische Eigenschaften hin untersucht werden können. Die modulare Software-Struktur erlaubt jedoch, erforderliche Nachbearbeitungen mithilfe einfacher Ergänzungen zu implementieren. Mit steigender Anzahl solcher Implementierungen wird die Anzahl zur Verfügung stehender standardisierter Ergänzungsmodule und dadurch auch der Funktionsumfang der Anwendung zunehmen.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Da die entwickelte Software zur automatisierten Auswertung nicht auf nur einen speziellen Anwendungsfall zugeschnitten ist, profitieren die Anbieter zahlreicher Anwendungsfälle und -nischen von den Ergebnissen. Biotechnische und medizinische Labore können mit der Software schneller belastbare und vergleichbare Ergebnisse erzielen. Software-Anbieter und KI-Entwicklungsunternehmen können ihr Produktportfolio um vergleichbare AutoML-Module erweitern und diese auf andere Anwendungsfelder transferieren, z. B. auf die Erkennung von Oberflächendefekten in der Produktionstechnik. Hersteller optischer Geräte, Laborequipment und photonischer Komponenten für die Zell-, Stammzellen- und Tumorforschung können durch Integration der Ergebnisse in bestehende Lösungen den Zeitaufwand für die Automatisierung der Auswertung reduzieren und deren Genauigkeit erhöhen. Unternehmen der genannten, KMU-dominierten Branchen können mit den Ergebnissen neue Geschäftsmodelle erschließen, z. B. den Vertrieb Hardware-unabhängiger Software-Abonnements.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT Aachen </li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>ALS Automated Lab Solutions GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Bayer AG</li> <li>Cellmatiq GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>IconPro GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Labforward GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>MABRI.VISION GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>MINDPEAK GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Olympus Soft Imaging Solutions GmbH</li> <li>ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG</li> <li>PicoQuant GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Ruhruniversität Bochum</li> <li>Stammzellnetzwerk NRW e. V.</li> <li>Taorad GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Uniklinik Köln</li> <li>Uniklinik RWTH Aachen</li> <li>Universitätsklinikum Bonn</li> <li>Universitätsmedizin Göttingen</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen ALS Automated Lab Solutions GmbH, Bayer AG, MABRI.VISION GmbH, PicoQuant GmbH und Taorad GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 21361 N der F.O.M. wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 248.918 EUR</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Administrationskosten vollständig durch freiwillige Förderbeiträge der Industrieunternehmen des Projektbegleitenden Ausschusses gedeckt</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=2063"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen</strong><br /> - 24.08.2022 (Fraunhofer IPT, Aachen)<br /> - 02.03.2022 (Webkonferenz)<br /> - 15.09.2021 (Webkonferenz)<br /> - 24.03.2021 (Webkonferenz)<br /> - 06.10.2020 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte</strong><br /> - Zwischenbericht für 2021<br /> - Zwischenbericht für 2020</li> <li><strong>Posterpräsentationen</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster 1 BMWK-Innovationstag Mittelstand 2022<br /> - Poster 2 BMWK-Innovationstag Mittelstand 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 23. Juni 2022 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
LaSaM
Laser-Strahlschmelzen amorpher Metallpulver – Entwicklung einer synergetischen Wertschöpfungskette durch Prozessoptimierung
|
(2020-2022)
|
F.O.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Hochtechnologie Materialien8
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Sonstige Metathemen13
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 21227 N (2020 - 2022)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Amorphe Metalle stellen eine innovative und für technische Anwendungen sehr potente Materialklasse dar. Sie verbinden die hohe Widerstandsfähigkeit von metallischen Werkstoffen mit hervorragenden elastischen Eigenschaften, die mit Kunststoffen vergleichbar sind. Die zur Herstellung notwendigen hohen Abkühlraten beschränken in Gussprozessen die Bauteilgröße auf einige Millimeter Durchmesser sowie die Komplexität der Bauteile. Die Additive Fertigung in Form des Laser-Strahlschmelzens (engl.: Powder Bed Fusion of Metals using a Laser Beam, kurz PBF-LB/M) erlaubt es, die bisherigen Restriktionen zu überwinden. Die schichtweise Fertigung und prozesstypisch hohen Abkühlraten können synergetisch genutzt werden, um einerseits komplexe und große amorphe Bauteile zu realisieren und anderseits die hohe Abkühlrate für einen technologischen Mehrwert zu funktionalisieren.<br /> <br /> In dem vorausgegangenen IGF-Projekt OptMetGlas (IGF-Nr. 19927 N) wurde die Herstellbarkeit amorpher Metalle auf Zr-Basis im PBF-LB/-Prozess erfolgreich demonstriert. Die mechanische Leistungsfähigkeit reicht nahezu an die gegossener Referenzproben heran. Es zeigten sich jedoch eigenschaftsbestimmende Abhängigkeiten vom Zustand des verwendeten Ausgangspulvers, die Qualität und Reproduzierbarkeit der Erzeugnisse maßgeblich beeinflussen.</p>
<h3>DIE IDEE DES INNOVATIONSPROJEKTS</h3>
<p>Ziel des IGF-Projekts LaSaM war es, ein verlässliches industrielles Herstellungsverfahren mit einer synergetischen, optimal abgestimmten Material- und Prozesskette für hochwertige Produkte aus amorphen Metallen mit bauteilspezifischer mechanischer Leistungsfähigkeit zu etablieren. Dazu sollten Parameter entlang der gesamten Prozesskette, von der Legierungsauswahl, der Legierungssynthese und der Verdüsung über den PBF-LB/M-Prozess bis zur Nachbearbeitung amorpher Bauteile analysiert und optimiert werden.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Die Prozesskette wurde anhand der Legierung Vitreloy 101 (Cu<sub>47</sub>Ti<sub>34</sub>Zr<sub>11</sub>Ni<sub>8</sub>, Vit101) und die durch Zugabe von Silizium (Si) und Silizium-Zinn (Si-Sn) mikrolegierten Derivate Vit101Si und Vit101SiSn untersucht: Die untersuchten Pulver erwiesen sich mit hoher Sphärizität und ausreichender Fließfähigkeit als geeignet für den PBF-LB/M-Prozess. Verschiedene vereinzelt aufgetretene Mikrodefekte konnten durch Parameteranpassung für ein relativ breites Prozessfenster weitestgehend eliminiert werden, sodass sich hochdichte (99,9 % optische Dichte) und vollamorphe (bestimmt mittels dynamischer Differenz-Thermoanalyse und Röntgendiffraktometrie) Proben erzeugen lassen. Die Volumenenergiedichten liegen zwischen 25 und 35 J/mm<sup>3</sup>.<br /> <br /> Die Untersuchung der material- und prozessseitigen Einflüsse auf die Defektausprägung ergab, dass vor allem Wechselwirkungen zwischen den belichteten Schichten zu schnell aufeinanderfolgender Scanvektoren im PBF-LB/M-Prozess ursächlich für eine ungewollte prozessinduzierte Kristallisation sind. Diese kann unabhängig von der Geometrie durch eine Verlängerung der Wartezeit zwischen zwei Vektoren vermieden werden.<br /> <br /> Obwohl Mikrolegieren die thermische Stabilität gegenüber Kristallisation erhöht, ist die Ausgangslegierung Vit101 den mikrolegierten Derivaten überlegen: Die Verringerung der Zähigkeit als Folge der Si- und Si-Sn-Zugabe erwies sich aufgrund während des PBF-LB/M-Verfahrens entstehender hoher Eigenspannungen als nicht geeignet. Die geringere thermische Stabilität bei höherer Zähigkeit erwies sich daher als besser geeignet. Die Legierungsentwicklungs-Strategien aus Gussverfahren können somit nicht auf die additive Fertigung übertragen werden.<br /> <br /> Die additiv gefertigten Vit101-Bauteile übertrafen gegossenes Vit101 deutlich in herstellbarer Größe und Komplexität. Über die Dreipunktbiegung wurden mechanisch-technologische Spannungs- und Dehnungseigenschaften untersucht: die Erzeugnisse wiesen keine plastische Verformung auf. Sie wiesen jedoch die zurzeit höchste dokumentierte Biegefestigkeit einer im PBF-LB/M-Verfahren hergestellten Probe von 2,47 GPa bei einer elastischen Dehnung von rund 2,5 % auf.<br /> <br /> Komplexe auxetische Strukturen und nachgiebige Mechanismen (sog. Compliant Mechanisms) konnten ebenfalls erfolgreich hergestellt werden. Daraus resultieren Bauteile, die aufgrund ihrer besonderen Funktionalität den konventionellen aus kristallinen Metallen überlegen sein können. Das erhaltene Eigenschaftsprofil eröffnet ein vielfältiges Applikationspotential für Leichtbauanwendungen, hochbelastete nachgiebige Systeme und auxetische Strukturen.<br /> <br /> Es wurde eine Prozesskette zur Herstellung amorpher Bauteile in nahezu beliebiger Größe und Komplexität aus Vit101 erfolgreich aufgebaut, die auf andere Anlagensysteme übertragen werden kann, lediglich limitiert durch die Anlagengröße und den Materialbedarf.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Pulverhersteller und Dienstleister im Bereich der additiven Fertigung, die oftmals KMU sind, können die Projektergebnisse nutzen, um ihr jeweiliges Materialportfolio um einen Hochleistungswerkstoff zu erweitern. Die hohe Festigkeit des Materials bietet sich besonders für hochbelastete Spezialanwendungen an. Solche Sonderanfertigungen werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette häufig von KMUs bedient.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Lehrstuhl Fertigungstechnik, Universität Duisburg-Essen</li> <li>Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe, Universität des Saarlandes</li> <li>Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien, Bremen</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>3D MicroPrint GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Aconity GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Additive Works GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>AMAZEMET <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Deutsche Edelstahlwerke Speciality Steel GmbH & Co. KG</li> <li>Fit Produktion GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK</li> <li>Hoeganaes Corp. Europe GmbH</li> <li>Günter-Köhler-Institut, Ifw Jena</li> <li>Indutherm Gießtechnologie GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>KARL STORZ SE & Co. KG</li> <li> <p>Lehrstuhl für Leichtbausysteme</p> </li> <li>Linde AG</li> <li>MBFZ toolcraft GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>MegaTherm Elektromaschinenbau GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Mettler-Toledo GmbH</li> <li>Nanoval GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Olympus Surgical Technologies Europe, Olympus Winter & Ibe GmbH</li> <li>PX Services SA <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Richard Wolf GmbH</li> <li>Rosswag GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SLM Solutions Group AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>TLS Technik GmbH & Co. Spezialpulver KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG</li> <li>Wenzler Medizintechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen 3D MicroPrint GmbH, Fit Produktion GmbH, Indutherm Gießtechnologie GmbH, KARL STORZ SE & Co. KG, Linde AG, MBFZ toolcraft GmbH, MegaTherm Elektromaschinenbau GmbH, Nanoval GmbH & Co. KG, Olympus Winter & Ibe GmbH, Richard Wolf GmbH, Rosswag GmbH und TLS Technik GmbH & Co. Spezialpulver KG an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 21227 N der F.O.M. wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 613.553 EUR</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Administrationskosten vollständig durch freiwillige Förderbeiträge der Industrieunternehmen des Projektbegleitenden Ausschusses gedeckt</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li class="Default" style="margin-left:8px">J. Wegner, M. Frey, R. Busch, S. Kleszczynski, Additive manufacturing of a compliant mechanism using Zr-based bulk metallic glass. Additive Manufacturing Letters 39 (2021) 100019. DOI: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772369021000190">10.1016/j.addlet.2021.100019</a></li> <li class="Default" style="margin-left:8px">E. Soares Barreto, M. Frey, J. Wegner, A. Jose, N. Neuber, R. Busch, S. Kleszczynski, L. Mädler, V. Uhlenwinkel, Properties of gas-atomized Cu-Ti-based metallic glass powders for additive manufacturing. Materials & Design 215 (2022) 110519. DOI: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026412752200140X?via%3Dihub">10.1016/j.matdes.2022.110519</a></li> <li class="Default" style="margin-left:8px">M. Frey, Jan Wegner, E. Soares Barreto, L. Ruschel, N. Neuber, B. Adam, S. S. Riegler, H. Jiang, G. Witt, N. Ellendt, V. Uhlenwinkel, S. Kleszczynski, R. Busch, Laser Powder Bed Fusion of Cu-Ti-Zr-Ni Bulk Metallic Glasses in the Vit101 Alloy System. Additive Manufacturing 66 (2023). DOI: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860423000805">10.1016/j.addma.2023.103467</a></li> <li class="Default" style="margin-left:8px">E. Soares Barreto, J. Wegner, M. Frey, S. Kleszczynski, R. Busch, V. Uhlenwinkel, L. Mädler, N. Ellendt, Influence of oxygen in the production chain of Cu-Ti-based metallic glasses via laser powder bed fusion. Powder Metallurgy, 8 (2023). DOI: <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00325899.2023.2179207">10.1080/00325899.2023.2179207</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=2066"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen</strong><br /> - 25.08.2022 (Webkonferenz)<br /> - 24.09.2021 (Webkonferenz)<br /> - 26.01.2021 (Webkonferenz)<br /> - 25.05.2020 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte</strong><br /> - Zwischenbericht für 2021<br /> - Zwischenbericht für 2020</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster BMWK-Innovationstag Mittelstand 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 23. Juni 2022 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
SpOC
Entwicklung eines Spektralphotometers spezifisch für die Qualifizierung komplexer optischer Beschichtungen
|
(2020-2023)
|
O.
|
|
Detektion, Diagnostik5
Opt. Messtechnik, Sensorik6
Oberflächen-Funktionalisierung7
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 21019 N (2020 - 2023)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Optische Komponenten werden häufig mit einer optischen, funktionsausstattenden oder vergütenden Beschichtung versehen. Eines der wichtigsten Werkzeuge für die Charakterisierung dieser Beschichtungen ist die Spektralphotometrie, mit der das spektrale Übertragungsverhalten und damit die Qualität geprüft wird. Aktuell verfügbare Spektralphotometer erreichen zwar eine hohe Präzision, sind jedoch nicht explizit für die Herausforderungen der Charakterisierung optischer Schichten ausgelegt und werden somit der heutigen Komplexität vieler optischer Beschichtungen nicht gerecht: Die genutzte Strahlaufbereitung und Detektion führen zu Messfehlern, die langen Messzeiten zu hohen Prozesskosten und mit der unzureichenden Absolutgenauigkeit und spektralen Auflösung können komplexe Spezifikationen einiger Komponentenklassen messtechnisch nicht nachgewiesen werden.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des IGF-Projekts war die Entwicklung eines modularen, spezifisch auf die Charakterisierung von optischen Komponenten und Dünnschichtsystemen im Spektralbereich 200 – 2.500 nm zugeschnittenen Spektralphotometers.<br /> <br /> Ein zu entwickelnder Laboraufbau auf Grundlage des gängigen Konzepts eines Zweistrahlphotometers sollte zum Einen eine verlässlich hohe Absolutgenauigkeit erzielen, weshalb Strahlversätze vermieden und die Detektion verbessert werden sollten. Hierfür sollten alternative Strahlungsquellen erprobt sowie eine Homogenisierung des Messtrahls und eine Nachführung für den Detektor entwickelt und evaluiert werden. Zum Anderen sollte das System eine hohe spektrale Auflösung erreichen. Hierfür sollte die Strahldivergenz am Probenort mithilfe einer abgewandelten Strahlaufbereitung für eine verbesserte Lichtausbeute und einer Kollimation des Strahls reduziert werden.<br /> <br /> Um die Prozesskosten zu reduzieren, sollte zudem ein hoher Probendurchsatz ermöglicht werden. Dafür sollte eine Probenaktorik inklusive angepasster Signalerfassung und Referenzierung entwickelt werden. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>In dem Projekt konnte ein Laboraufbau realisiert werden, der sowohl Messungen der Transmission als auch der Reflexion im Spektralbereich 200 nm bis 750 nm an Proben mit Durchmessern bis zu 50,8 mm ermöglicht.<br /> <br /> Als Grundlage wurde ein Doppelmonochromator genutzt, mit dem der übliche Strahlengang eines Zweistrahlphotometers realisiert wurde. Durch Anpassung der einzelnen Module konnte eine Absolutgenauigkeit von 0,1 % für Transmissions- und 0,2 % für Reflexionsmessungen von planparallelen, nicht-miniaturisierten Optiken erreicht werden. Hierfür wurde eine lasergepumpte Plasmalichtquelle genutzt, die aufgrund ihrer außerordentlichen Ausgangsleistung eine hohe Flexibilität in der Gestaltung des Strahlengangs hinsichtlich des Einsatzes von Strahlungsleistung reduzierenden Konzepten und Komponenten erlaubt. Zudem wurde ein holographischer Diffusor zur Homogenisierung des Messstrahls verwendet – polierte Diffusoren erwiesen sich als ungeeignet – und eine Nachführung für den Probendetektor realisiert, die einen schnellen Wechsel zwischen einer Transmissions- und einer Reflexionsmesskonfiguration ermöglicht.<br /> <br /> Das spektrale Auflösungsvermögen konnte im Vergleich zu bereits verfügbaren Spektralphotometern durch die höhere Lichtausbeute aufgrund der verwendeten Plasmalichtquelle und durch den Einsatz von drei Spalten für eine Kollimation des Messstrahls deutlich verbessert werden.<br /> <br /> Zur Steigerung des Probendurchsatzes wurde eine spezielle Aktorik in Form eines Probenrevolvers entwickelt, die jedoch noch einer detaillierten Erprobung bedarf.<br /> <br /> Insbesondere die mit dem entwickelten Demonstrator gemessenen Transmissionsspektren stimmten mit den bereitgestellten Vergleichsdaten überein. Ausnahmen bildeten die Bereiche nahe 200 nm und 700 – 750 nm, in denen höhere Abweichungen und vermehrtes Rauschen auftrat.<br /> <br /> Im Rahmen des Projekts wurden zudem weitere Herausforderungen aufgezeigt. Insbesondere der Doppelmonochromator, das Herzstück des Spektralphotometers, verursachte ein nur teilweise reduzierbares Strahlwandern, was die Leistungsfähigkeit des Geräts limitiert. Eine genauere Evaluation der Monochromator-Bauart sowie weitere mechanische Optimierungen der Proben- und Detektorhalterung sind daher unerlässlich. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Mit der Entwicklung eines Spektralphotometers spezifisch für die Charakterisierung von optischen Beschichtungen kann die Qualität der Beschichtungen hochspezieller optischer Komponenten, auf deren Herstellung viele KMU der Optik-Branche spezialisiert sind, bereits vor dem Einsatz in einer Anwendung überprüft werden, was die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärkt. Eine verbesserte Messtechnik kann zudem bspw. in der Laserindustrie die Entwicklungsdauern von neuen oder verbesserten Komponenten reduzieren und damit das Potenzial für die Entwicklung von Innovationen erhöhen. Hierdurch sind kurzfristig deutliche Steigerungen von Produktivität und Innovationskraft und somit auch der internationalen Konkurrenzfähigkeit möglich.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Laser Zentrum Hannover e. V.</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>Bühler Alzenau GmbH</li> <li>Carl Zeiss Spectroscopy GmbH</li> <li>DIOPTIC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>FHR Anlagenbau GmbH</li> <li>LASER COMPONENTS Germany GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LASEROPTIK GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LAYERTEC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Optics Balzer Jena GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>QIOPTIQ Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Bühler Alzenau GmbH, DIOPTIC GmbH, FHR Anlagenbau GmbH, LASER COMPONENTS Germany GmbH, LASEROPTIK GmbH, LAYERTEC GmbH, Optics Balzer Jena GMbH und QIOPTIQ Photonics GmbH & Co. KG an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 21019 N der F.O.M. wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 246.870 EUR</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Administrationskosten vollständig durch freiwillige Förderbeiträge der Industrieunternehmen des Projektbegleitenden Ausschusses gedeckt</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=2117"><b><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></b></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 22.03.2023 (Hybridveranstaltung)<br /> - 28.11.2022 (Hybridveranstaltung)<br /> - 15.07.2021 (Webkonferenz)<br /> - 05.11.2020 (Webkonferenz)<br /> - 26.05.2020 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2022<br /> - Zwischenbericht für 2021<br /> - Zwischenbericht für 2020</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020</li> </ul> |
|
XFloater
Mouches volantes: OCT-Erfassung und UKP-Laser Therapie
|
(2020-2022)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
3D-Visualisierung, Monitoring4
Detektion, Diagnostik5
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 01IF21011N (2020 - 2022)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Glaskörpertrübungen, sog. "Mouches volantes" oder "Vitreous Floaters", führen zur Wahrnehmung kleiner, scheinbar im Gesichtsfeld schwebender Punkte oder Fäden und beeinträchtigen teilweise das Sehen. Sie entstehen durch alters- oder stressbedingte Veränderungsprozesse des Glaskörpers. Die psychische Belastung und der Verlust an Lebensqualität der Patienten können erheblich sein.<br /> <br /> Mit der konventionellen Vitrektomie (chirurgische Entfernung von Glaskörperteilen) erzielen manche Kliniken nach eigenen Angaben Erfolgsraten über 80 %. Allerdings tritt bei diesem invasiven Ver-fahren in bis zu 60 % der Fälle Kataraktbildung (Grauer Star) auf. Auch werden Netzhaut (Retina)-Risse (bis 16,4 %) und -Ablösungen (bis 10,9 %) berichtet.<br /> <br /> Eine augenheilkundliche Lasertherapie, die Laser-Vitreolyse, ist bisher das einzige nichtinvasive Behandlungsverfahren und nutzt einen Nanosekundenlaser zur Floater-Verdampfung. Der hohe Energieeintrag kann nach teilweiser Energieumwandlung zu mechanischen Stoßwellen und einem 'Wegspringen' der Floater führen, zur Verletzung des hinteren Kapselsacks und Kataraktbildung sowie zu einer Schädigung der Retina und Auftreten eines Glaukoms (Grüner Star). Die Häufigkeitsangabe dieser Komplikationen variiert stark, was es möglich erscheinen lässt, dass der Behandlungserfolg wesentlich von der Erfahrung des behandelnden Arztes abhängt. Bisher mangelte es an einem umfassenden Verständnis aller Vorgänge bei der Laser-Vitreolyse sowie an ausreichender Kenntnis der Parameterräume. Für eine sichere, nebenwirkungsfreie Floater-Behandlung bestand hoher Forschungsbedarf. begrenzt.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Projektziel war, die Grundlagen für ein von Augenärzten ambulant durchführbares nichtinvasives Behandlungsverfahren mit modernsten Lasern mit ultrakurzen Pulsen (UKP-Laser) zu schaffen, mit ähnlich guten Behandlungserfolgsraten wie bei der Vitrektomie und mit einer exzellenten Sicherheit bezüglich Komplikationen. Hierzu sollten Parameter von UKP-Lasersystemen für einen effizienten Abbau von Floatern optimiert und mittels optischer Kohärenztomografie (OCT) mit einer exakten 3D-Erfassung in Echtzeit für eine spätere Automatisierung der Behandlung gekoppelt werden. Der Ener-gieeintrag sollte durch fokussierte Laserpulse von mJ auf 10 μJ reduziert werden.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Ein Experimentalaufbau für eine Laser-Behandlung mit Bildgebung für den ge-samten Augapfel konnte erfolgreich auf-gebaut werden und besteht aus einem OCT-Messarm, einem Lichtfaseraufbau für die eingekoppelte Femtosekunden (fs)-Laserstrahlung und einem Arm mit Probenhalterung beziehungsweise Patienten-Interface mit Kontaktglas. Nach Synchronisation der Komponenten und Entwicklung der Software-Ansteuerung konnten untersuchte Strukturen dreidimensional erfasst und abgebildet werden. Mithilfe einer Flüssiglinse konnten die Fokusse von OCT- und fs-Laser gemeinsam um bis zu 13 mm verschoben werden, bei gleichbleibendem Strahldurchmesser. Ein solcher Aufbau erspart Vitreolyse-Patienten das unangenehme Wechseln des Patienten-Interfaces mit variierenden Brechungsstärken.<br /> <br /> Um bei den Versuchsreihen Verfälschungen durch individuelle Floaterausprägungen zu vermeiden, wurde ein Glaskörpermodell mit einem additiv gefertigten Silikonhohlauge und einer einstellbaren Hydrogel-Füllung entwickelt. Über die Viskosität des Hydrogels lassen sich verschiedene Verflüssigungsgrade des Glaskörpers simulieren, die für die unterschiedliche Beweglichkeit der Floater verantwortlich sein könnten. Über die Geometrie der Silikon-'Hornhaut' (Cornea) wird die Brechkraft des Modellauges ohne gesonderte Linse an die des menschlichen Auges angepasst.<br /> <br /> Zur 3D-Lokalisierung der Floater anhand von OCT-Bildern wurde ein Algorithmus entwickelt, der Floater aus den Volumendaten in Segmente zerlegt. Dies ermöglicht die Identifizierung und automatisierbare Ansteuerung geeigneter Koordinaten für die Aktivierung und Deaktivierung des Behandlungslasers. Der kontrollierbare Retina-Floater-Abstand ermöglicht die Vermeidung einer Laserpulssetzung in der Nähe sensibler Strukturen.<br /> <br /> Für den mit dem Demonstratoraufbau realisierbaren kleinsten Fokusdurchmesser war ein Floater-Abbau durch fs-Laser bereits bei Pulsenergien ab 10 μJ und Pulsraten von 500 kHz nachzuweisen. Die fs-Laserpulse bewirkten ein deutlich selteneres Wegspringen der Floater, was auf eine geringere mechanische Beanspruchung des umliegenden Gewebes hinweist. Diese schonendere Behandlung erlaubt, Floater in größerer Nähe zu sensiblen Strukturen des Auges zu bestrahlen als bisher. Zu beachten ist jedoch, dass fs-Laser nicht-lineare Effekte erzeugen, von denen einige wissenschaftlich noch nicht vollständig erfasst sind. Die Ausschließbarkeit sichtbarer oder funktionaler Schäden der Retina durch eine fs-Laser-Vitreolyse nahe der Retina ist am effektivsten über Tierversuche nachweisbar.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Der entwickelte Aufbau unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem der aktuell verwendeten klinischen OCT-Systeme. Die Hersteller bestehender Lasersysteme zur Untersuchung von Cornea oder Retina können diese Funktionen durch geringe technische Modifikationen, wie die Erweiterung des Sichtbereichs in den Glaskörper hinein, so anpassen, dass sich zusätzlich Floater-Behandlungen mit erhöhter Verfahrenssicherheit durchführen lassen. Die Möglichkeit des Zurückgreifens auf bestehende Systeme erlaubt eine kostengünstige und schnelle Entwicklung von Modulen zur sichereren Vitreolyse. Dies lässt sich insbesondere von KMU nutzen, die bereits als Know-how-Träger, Inverkehrbringer und Zulieferer der benötigten Technologien, z. B. zur Strahlformung, Bildgebung und Laserführung, fungieren.</p>
<h3>ERGÄNZENDE STUDIE ZU GLASKÖRPERTRÜBUNGEN IM AUGE</h3>
<p><span style="color: rgb(0, 100, 165)">Die auch als "Mouches volantes", "Fliegende Mücken" oder "Floater" bezeichneten Glaskörpertrübungen des Auges können die Lebensqualität Betroffener durch eine in manchen Fällen sehr störende Beeinträchtigung des Sehens erheblich herabsetzen und dennoch wird immer wieder davon berichtet, dass sogar manche Ärzte noch heute die Einschränkungen durch die Symptome nicht ernst nähmen. Die Ursache hierfür liegt zum großen Teil an der unzureichenden Datengrundlage dieses jungen Forschungsfeldes.<br /> <br /> Die F.O.M. und der mit ihr kooperierenden Industrieverband SPECTARIS luden daher Betroffene ein, bei der Verbesserung des Wissensstandes mitzuwirken. Durch die Teilnahme an der von F.O.M. und SPECTARIS geförderten Studie des Laser Zentrums Hannover (LZH) unterstützten bis August 2023 über 1.400 Personen unter anderem die Erfassung möglicher Entstehungsursachen und die Erstellung eines umfassenden Kataloges unterschiedlicher Ausprägungen der Glaskörpertrübungen. Diese Informationen wurden für die Forschung im Rahmen des IGF-Projekts "XFloater" der F.O.M. herangezogen und stehen auch bei der Erforschung und Entwicklung neuer Therapieansätze durch andere auf Anfrage frei zur Verfügung.</span></p>
<h3>COMPLEMENTARY STUDY ON EYE FLOATERS</h3>
<p><span style="color: rgb(0, 100, 165)">The vitreous opacities of the eye, also known as "mouches volantes" or "floaters", can considerably reduce the quality of life, and yet it is reported that some doctors do not take the restrictions caused by the symptoms seriously. The reason for this is largely due to the insufficient data base of this young field of research.<br /> <br /> The F.O.M. and the cooperating industry association SPECTARIS sponsored a study of the Laser Zentrum Hannover (LZH) and invited affected persons to participate. The recording of possible causes of occurrence and the compilation of a comprehensive catalog of different manifestations of more than 1.400 affected supported the research of the IGF project "XFloater" of the F.O.M. The obtained data of this survey is also available for the development of new therapeutic approaches by others.</span></p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Laser Zentrum Hannover e. V., Hannover</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss</strong><strong>, "PA") </strong></p>
<ul> <li>ARGES GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Carl Zeiss Meditec AG</li> <li>IOP GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Medizinische Hochschule Hannover</li> <li>neoLASE GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Dr. Kermani VISION GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>OptoMedical Technologies GmbH</li> <li>Optores GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>QIOPTIQ Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>Robert Bosch GmbH</li> <li>Rowiak GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen ARGES GmbH, Carl Zeiss Meditec GmbH, QIOPTIQ Photonics GmbH & Co. KG und Rowiak GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 21011 N der F.O.M. wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 249.714 EUR</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Administrationskosten vollständig durch freiwillige Förderbeiträge der Industrieunternehmen des Projektbegleitenden Ausschusses gedeckt</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li>Lippek, J., Dyrøy, P., Zabic, M., Heinemann, D., Johannsmeier, S., Ripken, T., OCT visualization of ocular opacities for laser-based treatment of eye floaters. <em>Procedia DGBMT</em>, <strong>2021</strong>.</li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=2075"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 10.10.2022 (Webkonferenz)<br /> - 07.12.2021 (Webkonferenz)<br /> - 15.07.2021 (Webkonferenz)<br /> - 20.04.2020 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2021<br /> - Zwischenbericht für 2020</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster Internationale Ophthalmologie Konf. (ARVO) 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 15. Juni 2023 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
ULTRAHARD
Internationales Projekt: Ultrahard optical diamond coatings
|
(2020-2022)
|
F.O.
|
|
Hochtechnologie Materialien8
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Sonstige Metathemen13
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 263 EN (2020 - 2022)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Ein transparenter Kratzschutz oder eine Kombination aus Kratzschutz und einer Antireflexbeschichtung (AR-) wird heute in vielen Industriezweigen eingesetzt: von der Uhrenindustrie über optische Instrumente und Sensorsysteme bis hin zur Medizintechnik. Der Kratzschutz bestimmt oft die Einsetzbarkeit und die Lebensdauer optischer Bauteile. Ist das Glas einer Armbanduhr oder die Linse eines optischen Messsystems zerkratzt oder durch Abrieb eingetrübt, ist eine weitere Nutzung oftmals nicht mehr möglich. Die existierenden Beschichtungslösungen für einen transparenten Kratzschutz stoßen jedoch an physikalische Grenzen. Die Nachfrage nach verbessertem Kratzschutz und damit längeren Produktlebensdauern steigt daher stetig.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des IGF-Projekts war die Entwicklung ultraharter transparenter Diamantschichten für optische Anwendungen. Hierfür sollten dünne (< 500 nm) und überaus glatte Diamantschichten auf verschiedenen Substraten (Quarzglas, Borosilikatglas, Floatglas, Saphir) aufgebracht werden. Für die Herstellung von AR-Schichtstapeln sollten zudem Diamantschichten mit exakt definierten Dicken in Mehrschichtsysteme aus niedrig- und mittelbrechenden konventionellen Schichten (Siliziumoxid und Siliziumnitrid) eingebettet werden. Um einen möglichst großen Nutzen solcher Schichtsysteme für optische Anwendungen zu erzielen, sollten sie eine hohe Transmission, eine geringe Absorption sowie möglichst keine Streuung und Reflektion aufweisen. Die erhöhte Kratzfestigkeit beziehungsweise die erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit gegenüber abrasiven Belastungen soll hierbei durch die hohe Härte und Verschleißfestigkeit von Diamant erreicht werden.<br /> <br /> Um teilweise temperaturempfindliche Grundkörper auf Flächen von mindestens 100 mm x 100 mm mit hoher Homogenität und hohen Schichtwachstumsraten wirtschaftlich beschichten zu können, mussten die Substratvorbehandlung und die Prozessauslegung der beiden Beschichtungsverfahren HFCVD (Heißdraht-aktivierte Gasphasenabscheidung) und mikrowellenunterstützte PACVD (Plasma-aktivierte Gasphasenabscheidung) optimiert werden. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>In einem ersten Schritt wurde der HFCVD-Beschichtungsprozess so angepasst, dass die Beschichtungstemperatur auf ca. 680 °C gesenkt werden konnte, sodass neben Quarzglas und Saphir auch temperatursensitive Gläser wie Borosilikatglas erfolgreich beschichtet werden können. Mit dem PACVD-Beschichtungsprozess ist durch die niedrige Beschichtungstemperatur sogar die Beschichtung von Floatglas möglich. Zudem wurden verschiedene Strategien zur Substratreinigung und -bekeimung (z. B. Ultraschall-sprühbasiert) optimiert. <br /> <br /> Mit den optimierten Prozessen wurden erfolgreich Demonstratoren mit Grundflächen bis 300 mm x 300 mm aus Borosilikat- oder Quarzglas mit einer transparenten, ultraharten Diamantschicht hergestellt. Unterschiedliche Schichtsysteme (z. B. Diamantschicht mit niedrigbrechender Siliziumoxid-Deckschicht) und AR-Schichtstapel aus vier Schichten (Siliziumnitrid – Siliziumoxid – Diamantschicht – Siliziumoxid) wurden erfolgreich vollständig mit dem HFCVD-Prozess aufgebracht. Untersuchungen der mechanischen und optischen Eigenschaften verschieden hergestellter Schichtsysteme lieferten teilweise sehr gute Ergebnisse: <br /> <br /> Die auf Quarz- oder Boroslikatglas abgeschiedenen Diamantschichten und die Mehrschichtsysteme zeigen hohe Haftfestigkeiten, sodass keine Delaminationen nach der Beschichtung auftreten. Im Sandrieseltest wurden insbesondere bei Proben aus den kühleren HFCVD-Beschichtungsprozessen sehr gute Ergebnisse erzielt, bei denen lediglich vereinzelt Schichtschädigungen nach Aufprall von 3 kg Quarzsand auftreten. Die vergleichsweise weiche Siliziumoxid-Deckschicht stabilisiert das Gesamtsystem und setzt das Schädigungsmaß herab.<br /> <br /> Bei reinen Diamantschichten erhöht sich die Transmission und sinkt die Absorption mit sinkender Beschichtungstemperatur. Das Aufbringen einer Siliziumoxid-Deckschicht auf Einzelschichten und Mehrschichtsysteme erhöht die Transmission zusätzlich. Die Absorption bleibt jedoch trotz allem zu hoch, sodass eine weitere Optimierung nötig ist, um Diamantschichten auch für optische Komponenten nutzbar zu machen. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Zur Herstellung ultraresistenter, transparenter Oberflächen und hochharter AR-Schichtstapel können Diamantschichten auf verschiedene Glassubstrate aufgebracht oder in Mehrschichtsysteme integriert werden. Bei optischen Bauteilen müssen die Schichten entsprechend der anwendungsspezifischen Anforderungen der mittelständisch geprägten Photonikindustrie (z. B. sehr geringe Absorption) weiter angepasst werden. Dann können die hochharten, verschleißfesten und chemisch inerten Diamant-Dünnschichten beispielsweise auch als Medium mit hohem Brechungsindex eingesetzt werden. Wenn die optischen Eigenschaften zweitrangig sind, lassen sich die Schichten durch die erzielte Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen bereits jetzt für Anwendungen unter herausfordernden abrasiven Umgebungsbedingungen (z. B. Hitze, Sand, Korrosion) einsetzen. Die Möglichkeit, alternativ die HFCVD- oder die PACVD-Beschichtungstechnologie zu verwenden, um die den Diamantfilm umgebenden Schichten abzuscheiden, erhöht die Flexibilität der Unternehmen in Bezug auf die genutzte Beschichtungsanlage.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen:</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST Braunschweig (Deutschland)</li> <li>Interuniversity microelectronic centre, Institute for Materials Research in Microelectronics (Belgien)</li> <li>Hasselt University, Faculty of Sciences, Hasselt (Belgien)</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>ASKANIA Mikroskop Technik Rathenow GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ASML Berlin GmbH</li> <li>Blösch AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>CREAVAC – Creative Vakuumbeschichtungen GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>GD Optical Components GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Plasus GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>PrinzOptics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>QIOPTIQ Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>W&L Coating Systems GmbH</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen ASML Berlin GmbH, Blösch AG, CREAVAC - Creative Vakuumbeschichtung GmbH, GD Optical Competence GmbH, PLASUS GmbH, PRINZ OPTICS GmbH und W&L Coating Systems GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 263 EN , der Förderlinie CORNET, der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 262.132 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li>Verding P, Pobedinskas P, Joy RM, Ahmed E, Remes Z, Kumar RSN, Baron S, Höfer M, Sittinger V, Nesládek M, Haenen K, Deferme W. The influence of droplet-based seeding of nanodiamond particles on the morphological, optical, and mechanical properties of diamond coatings on glass. <em>Surf Coat Technol. </em><b>2023</b>; 459:129391. DOI: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0257897223001664?via%3Dihub">10.1016/j.surfcoat.2023.129391</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1978"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 31.03.2022 (Webkonferenz)<br /> - 16.12.2021 (Webkonferenz)<br /> - 21.05.2021 (Webkonferenz)<br /> - 01.10.2020 (Webkonferenz)<br /> - 17.01.2020 (Hasselt University, Faculty of Sciences, Hasselt (Belgien))</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2021<br /> - Zwischenbericht für 2020</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul> |
|
InfektResonator
Mikroresonatoren für die Point-of-care-Diagnostik pathogener Keime
|
(2019-2022)
|
M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Detektion, Diagnostik5
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 20934 N (2019 - 2022)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Bei stationären Behandlungen kommt es durch ungezielten und übermäßigen Einsatz von Antibiotika immer häufiger zu oft tödlichen Infektionen durch (multi-)resistente Erreger sowie zu weiteren Resistenzen. Um diese Entwicklung aufzuhalten und die Chancen auf Therapieerfolg zu erhöhen, ist es nötig, schneller belastbare und differenzierte diagnostische Daten zu den Erregern zu erhalten.<br /> <br /> Im klinischen Alltag werden aktuell Antibiogramme zur Bestimmung von Resistenzen genutzt, wofür die Erreger oft zuvor bis zu 48 Stunden kultiviert werden müssen. Einige Keime, wie beispielsweise Methicillin-resistente Staphylococcuslococcus aureus (MRSA) sind zwar durch moderne PCR-Methoden in wenigen Stunden detektierbar, jedoch können andere klinisch relevante Bakterien, wie z. B. Extended-spectrum Beta-Laktamase (ESBL) und Carbapenemase-produzierende Enterobakterien (CPE), erst durch ein erweitertes Biomarkerspektrum eindeutig identifiziert werden. Ein breites Biomarker-basiertes Screening ist allerdings aufgrund der verschiedenen Arten von Markerklassen unterschiedlicher Biomoleküle und den niedrigen Analytgehalten in Primärproben weiterhin ein ungelöstes Problem bei der Entwicklung schneller Diagnostikmethoden.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel war die Entwicklung eines innovativen hochsensitiven Analysesystems, mit dem multiresistente Keime anhand neu erschlossener Biomarker schnell identifiziert werden können, selbst bei geringer Konzentration und ohne vorausgehende Kultivierung. Hierzu sollte eine Sensorik auf Basis von Whispering Gallery Mode (WGM)-Ringresonatoren genutzt werden. Dabei wird das wiederholt um Mikropartikel umlaufende Licht erfasst, das diese bei Resonanz zur Mitschwingung anregt. Die Mikropartikel sollten derart biofunktionalisiert werden, dass geeignete Fängermoleküle (z. B. Antikörper, Antibiotikum) an der Oberfläche der Partikel anhaften. Werden dann charakteristische Resistenzgenprodukte resistenter Bakterienstämme wie das Protein Beta-Laktamase zugegeben, sollte die Analyse mit WGMs Auskunft über eine Bindung des Zielsubstrats an die Fängermoleküle geben, um Rückschlüsse auf die vorliegenden Bakterienstämme und Resistenzen zu erlauben. Bereits etablierte Immunoassay-Systeme zum Nachweis von Allergen- oder Autoimmunbiomarkern sollten ebenfalls getestet werden.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Antikörper und Antibiotika ließen sich an ca. 10 µm große Polystyrol-Partikel, funktionalisiert mit Carboxyl- und Aldehydgruppen sowie dem Protein G, anbinden. Mit der WGM-Analyse konnte die Interaktion zwischen den Antikörpern beziehungsweise Antibiotika auf den Partikeln und den zugegebenen Enzymen Beta-Laktamase in Echtzeit nachgewiesen und quantifiziert werden. Die Carboxyl-funktionalisierten Partikel erbrachten die besten Ergebnisse, während die zugegebene Beta-Laktamase sowohl mit den Antikörpern als auch mit dem Protein G eine unerwünschte Bindung einging. Die Bindungen zwischen Antikörpern und Beta-Laktamase wurden mit kostspieligeren und zeitintensiveren gängigen Methoden wie der Oberflächenplasmonenresonanzspektroskopie bestätigt.<br /> <br /> Die Detektionsgrenze, bis zu der Beta-Laktamase TEM-1 noch erfasst werden konnte, lag bei 10 µg/ml. Kleinstmoleküle wie diverse Antibiotika mit Massen kleiner als 1.000 Da konnten so indirekt durch Zugabe von Beta-Laktamase über den Nachweis der entstehenden Bindungen nachgewiesen werden. Zur Auswertung der WGM-Signale wurde eine Software entwickelt, die es ermöglicht, ohne tiefergehende Kenntnisse der Bioinformatik oder der Mikroresonatoren verlässliche Ergebnisse zu erzielen.<br /> <br /> Es konnten auch ganze Organismen wie die Bakterien Legionella pneumophila subsp. pneumophila trotz geringer Konzentration in wässriger Lösung unter Verwendung von polyklonalen Antikörpern nachgewiesen und die Koloniezahl quantifiziert werden.<br /> <br /> Analysen zur Überprüfung der Eignung der WGM-Analyse für diagnostische Tests an Blutproben anhand des fötalen Kälberserums zeigten deutliche Diskrepanzen in den Resonanzspektren und Verschiebungen der Schwingungsmoden. Ursachen können z. B. in einer Beeinträchtigung der Messergebnisse durch die veränderte Farbe oder möglichen Wechselwirkungen mit verschiedenen Bestandteilen des Serums (Hämoglobin, Cholesterin, etc.) liegen. Auch durch starke Verdünnung waren keine verwertbaren Ergebnisse zu gewinnen. Um Blut mit dem WGM-System analysieren zu können, bedarf es somit weiterer Forschung zur Analyse und Korrektur von Störfaktoren.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Die Vorteile der WGM-Analyse liegen in der hohen Sensitivität und der schnellen und leicht zu erlernenden Anwendung. Die Schnelligkeit der Nachweise ist perspektivisch vor allem in der medizinischen Diagnostik von Vorteil, da hier oftmals jeder Zeitgewinn ein Gewinn für den Patienten ist. Weiterhin bietet das WGM-System auch einen finanziellen Vorteil für den Anwender, da die Verbrauchsmaterialien, die für den Betrieb benötigt werden, sehr günstig sind.<br /> <br /> Die eingesetzten Resonatoren und Geräte werden zum Großteil von KMU entwickelt. Daher profitieren vor allem die KMU, die die WGM-Analyse für neue Bereiche erschließen können: z. B. in der medizinischen Diagnostik, besonders in der Krebsforschung, in der Analytik von Boden, Wasser (Trink- und Abwasser, Qualitätskontrollen für Seen und Flüsse) und Luft sowie für Nachweise umweltschädlicher Stoffe. Hier können KMU auch als Dienstleister fungieren.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong><strong>einrichtung</strong></strong></p>
<ul> <li>Hochschule Furtwangen, Institute of Precision Medicine IPM</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>DIARECT AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>InfanDx AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Laborärzte Singen GbR <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>M24You GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>NanoBioAnalytics <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>QIAGEN Lake Constance GmbH</li> <li>SmartDyeLivery GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> <li>Steinbeis GmbH für Technologietransfer</li> <li>Surflay Nanotex GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Uniklinik RTWH Aachen</li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen InfanDx AG, Laborärzte Singen GbR, M24You GmbH, NanoBioAnalytics, SmartDyeLivery GmbH, Steinbeis GmbH für Technologietransfer und Surflay Nanotex GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 20934 N der F.O.M. wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 244.662 EUR</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=2082"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 14.12.2022 (Webkonferenz)<br /> - 14.02.2022 (Webkonferenz)<br /> - 08.11.2021 (Webkonferenz)<br /> - 05.06.2020 (Webkonferenz)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2021<br /> - Zwischenbericht für 2019/2020</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 15. Juni 2023 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
LightTraum
Entwicklung der LightPLAS-Schichtchemie zur Adhäsionsreduzierung von humanen Zellen auf Traumaimplantaten
|
(2019-2022)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Oberflächen-Funktionalisierung7
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 20423 N (2019 - 2022)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Bei der Versorgung von Knochenfrakturen werden Implantate eingesetzt, welche oft nicht dauerhaft im Körper verbleiben. Beispiele hierfür sind Traumaimplantate im Bereich der Osteosynthese oder Marknägel. Die spätere Entnahme ist oft durch Zellbewuchseffekte, wie stark anhaftende Knochenzellen, erschwert. Für den Operateur ist schwer entfernbares Gewebe für die Sicht auf das Implantat nachteilig. Kritisch sind zudem Schrauben, die nicht mehr herausgedreht werden können oder sogar brechen. Eine starke Zelladhäsion ist somit Ursache hoher OP-Risiken und Versorgungskosten.<br /> <br /> Im vorausgegangenen IGF-Projekt Licht als Werkzeug (17957 N) wurde die effektive Reduktion der Zellhaftung durch ein LightPLAS-beschichtetes Implantat erfolgreich demonstriert. Für die Umsetzung und Nutzung der LightPLAS-Beschichtung bestanden jedoch noch Unsicherheiten bezüglich der Prozesssicherheit. Diese betrafen insbesondere den potenziellen Einfluss umgebender Medien, die Reduktion der Zellhaftung anderer Zelllinien, den Nachweis der Biokompatibilität sowie eine detaillierte Kostenabschätzung.</p>
<h3>DIE IDEE DES INNOVATIONSPROJEKTS</h3>
<p>Ziel des Projekts war es, verbliebene Nutzungshürden durch Erhöhung der Prozesssicherheit abzubauen. Hierzu wurde die Effektivität bei weiteren Zelltypen (Fibroblasten sowie lebende Osteoblasten-Zellkulturen) unter statischen und fluiden Strömungsbedingungen untersucht, die statistische Evaluierung erweitert und eine konkrete Prozesstechnik erarbeitet.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Aufbauend auf den Ergebnissen aus dem Projekt Licht als Werkzeug wurde zunächst das Schichtdesign der LightPLAS-Beschichtung optimiert: Für polierten Edelstahl konnte eine deutliche Optimierung der Schichthomogenität (Schichtdickenabweichung < 1 %) und eine Erhöhung der Beständigkeit gegenüber der Dampfsterilisation erzielt werden. Auch die Anzahl lokaler Schichtdickenerhöhungen durch Staubeinschluss konnte deutlich reduziert werden. Es verblieben dennoch einige Menisken auf der beschichteten Oberfläche, die Ausgangspunkte für lokale Schichtablösungen bilden können, beispielsweise nach einmonatiger Auslagerung der Edelstahlmuster in einem Nährmedium mit Antibiotikazusatz oder nach mechanischer Reinigung. Der nach der Verfahrensoptimierung verbliebene Flächenanteil der Schichtablösungen ist jedoch gegenüber der Gesamtfläche des Implantats als klein zu bezeichnen. Bei einer Auslagerung der beschichteten Edelstahlmuster in reinem Wasser oder einer wässrigen Fibrinogenlösung zeigte sich eine dauerhafte Schichtstabilität bis zu mehreren Monaten.<br /> <br /> Die biologischen Bewertungsverfahren zur Zellhaftung erfolgten mit hoher statistischer Absicherung unter Berücksichtigung umgebender Gewebe, insbesondere mit Betrachtung der Proteinadsorption.<br /> <br /> Die Biokompatibilität der LightPLAS-Beschichtung konnte auf zehn unabhängig voneinander hergestellten Mustern mithilfe der Nutzung des WST-1 Assays in Anlehnung an die DIN EN ISO 10993-5 und 10993-12 nachgewiesen werden. Die adhäsionsmindernden Eigenschaften wurden an Fibroblasten sowie an lebenden Osteoblasten-Zellkulturen unter statischen und fluiden Strömungsbedingungen untersucht. Mit hoher statistischer Absicherung konnte eine signifikante Abnahme der Zellanzahl auf dem Edelstahlmuster durch die entwickelte Beschichtung von bis zu 70 % festgestellt werden. Eine anfänglich feststellbare erhöhte Zirkularität in der Zellmorphologie verlor sich jedoch nach 25 h Beobachtungszeit.<br /> <br /> Der Einfluss der Beschichtung auf den Effekt der Kaltverschweißung wurde mit einem geeigneten Prüfstand bewertet. Diese Untersuchungen zeigten keine signifikanten Korrelationen.<br /> <br /> Zur Einschätzung der 3D-Eignung wurden Simulationen mit einer Ray-Tracing Software durchgeführt. Auf Basis der ermittelten Bestrahlungsstärken und der Solldosis für den Beschichtungsprozess kann eine zukünftige Prozesskonzeptionierung erarbeitet werden.<br /> <br /> Beispielhaft wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für eine Konzeptstudie durchgeführt und ergab Beschichtungskosten bei einem Durchsatz von 20.000 bis 150.000 Implantaten pro Jahr in Höhe von 2,40 bis 7,30 Euro pro Implantat.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Mit dem Projekt konnten viele der offenen Fragestellungen zur Prozesssicherheit beantwortet, aber auch Limitierungen der Technologie identifiziert werden. Eine skalierbare Prozessanlage wurde beispielhaft konzipiert und detailliert wirtschaftlich für Bedürfnisse von KMU analysiert. Unternehmen haben nun eine belastbare Grundlage, um das Risiko einer Investition abschätzen zu können.<br /> <br /> Die Ergebnisse sind weitgehend auf andere Materialien, wie z. B. Titan oder Kunststoffe, andere Implantatklassen sowie auf andere Medizinprodukte oder Biosensoren übertragbar. Sie helfen insbesondere mittelständischen Medizintechnik-Unternehmen bei der Entwicklung hochwertiger Innovationen.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss,</strong> <strong> "PA"</strong><strong>)</strong></p>
<ul> <li>Bio-Gate AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Evonik Nutrition & Care GmbH</li> <li>Induflex Sondermaschinenbau GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Innovative Oberflächentechnologien GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>KLS Martin Group</li> <li>Kliniken der Stadt Köln gGmbH</li> <li>Naturalize GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Plasmatreat GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Radium Lampenwerk GmbH</li> <li>SITEC Industrietechnolgie GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> <li>Tricumed Medizintechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Bio-Gate AG, Innovative Oberflächentechnologien GmbH, KLS Martin Group, Plasmatreat GmbH, Radium Lampenwerk GmbH, SITEC Industrietechnologien GmbH und Tricum Medizintechnik GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 20423 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 249.750 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li>Böker KO, Gätjen L, Dölle C, Vasic K, Taheri S, Lehmann W, Schilling AF. Reduced Cell Adhesion on LightPLAS-Coated Implant Surfaces in a Three-Dimensional Bioreactor System. <em>Int. J. Mol. Sci.</em> <b>2023</b>, 24, 11608. <a href="https://www.mdpi.com/1422-0067/24/14/11608">DOI: https://doi.org/10.3390/ijms241411608</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=2012"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 26.04.2022 (Webkonferenz)<br /> - 07.07.2021 (Webkonferenz)<br /> - 29.10.2020 (Webkonferenz)<br /> - 16.01.2020 (Fraunhofer IFAM, Bremen)</li> <li><strong>Zwischenbericht</strong><br /> - Zwischenbericht für 2021<br /> - Zwischenbericht für 2019/2020</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul> |
|
Ink-Eye
3D-Polymerdruck von Brillengläsern
|
(2019-2021)
|
F.O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Hochtechnologie Materialien8
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 20750 BG (2019 - 2021)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>3Die industrielle Herstellung optischer Bauteile erfolgt derzeit vornehmlich klassisch durch Schleif-, Polier- und Freiformbearbeitung von gegossenen oder replizierten Glas- und Polymerpreformen. Nur mit diesen Verfahren lassen sich aktuell die benötigten sehr geringen Toleranzen in der Konturtreue der optischen Oberflächen und die hohe Transparenz der vollständig bearbeiteten optischen Bauteile erreichen. Eine kostengünstige Herstellung ist somit nur bei Optiken mit einfachen Geometrien und sehr hohen Stückzahlen erzielbar. Es zeichnet sich jedoch ein Trend zu individualisierten Optiken mit teils komplexen Geometrien für verschiedenste Anwendungen ab. Dieser Trend hat sich z. B. bei der Herstellung von Brillengläsern, bei der kleinste Stückzahlen bis zu einzelnen individualisierten Gläsern realisiert werden müssen, bereits durchgesetzt. Für solche Optiken sind die klassischen Bearbeitungsverfahren sehr kostenintensiv. Die additive Fertigung hat das Potenzial, hier einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Die hohen Anforderungen an die zu realisierende Transparenz und Formtreue haben allerdings den Einsatz der additiven Fertigung für optische Komponenten bisher verhindert.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel war die Entwicklung eines Fertigungsprozesses zur kostengünstigen Herstellung individualisierbarer Brillengläser mittels 3D-Tintenstrahldruck in vertretbaren Prozesszeiten. Die Form der gedruckten Gläser sollte über die gesamte Oberfläche weniger als 100 µm abweichen. Die Rautiefe (vertikaler Abstand zwischen höchstem und niedrigstem Punkt des Oberflächenprofils) sollte weniger als 5 µm und der Quadratische Mittenrauwert (Mittelwert der quadratischen Höhenabweichungen von der Mittellinie des Oberflächenprofils) weniger als 5 nm betragen. Durch schichtweisen Tintenstrahldruck und UV-Aushärten optischer Polymere sollten Volumenkörper mit einem Brechungsindex n > 1,5 und einer vergleichbaren Transparenz und Bruchfestigkeit zu bisherigen Kunststoff-Brillengläsern (z. B. CR39) hergestellt werden. Das Aufbringen einer Kratzfestbeschichtung sollte eine vielfach benötigte Funktionalisierung ermöglichen. Zur Erreichung der Ziele sollten bestehende Materialien angepasst und neue Materialien entwickelt werden, die mit einem Tintenstrahldrucker verarbeitbar sind. Der Druckprozess selbst sollte für den Druck optisch homogener Gläser optimiert werden.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Zur Herstellung der Volumenkörper und Kratzfestbeschichtung der Brillengläser wurden verdruckbare Polymermaterialien entwickelt: Bei den entwickelten Materialen für die Volumenkörper konnten ein Brechungsindex n > 1,55, eine Abbe-Zahl ν > 55 und gleichzeitig geringe Absorptionswerte (A) im sichtbaren Bereich (A < 1 %) erreicht werden. Zudem konnten die Viskositäten der Drucktinten im Bereich von η < 40 mPa·s sowie hohe Glasübergangstemperaturen der mit den Tinten hergestellten UV-vernetzten Volumenkörper von Tg > 90 °C erreicht werden. Für die Kratzfestbeschichtung wurden neuartige Hybridpolymer-Formulierungen aus der Materialklasse der ORMOCER®e entwickelt, die neben einer hohen Transparenz (A < 1,5 % bei 450 nm, A < 0,5 % bei > 500 nm) eine hohe Kratzfestigkeit aufweisen: Die maximal erzielte Schichthärte lag bei mehr als 350 MPa bei einer gleichzeitig hohen Schichthaftung auf dem Volumenmaterial. Zudem konnten Viskositäten der verdruckbaren Tinten in dem Bereich η < 40 mPa·s erreicht werden.<br /> <br /> Parallel wurde der 3D-Tintenstrahldruckprozess für den Druck von Brillengläsern angepasst. Dazu wurden zunächst Einzellagen der entwickelten Materialien auf gekrümmte Substrate gedruckt und anschließend mittels UV-Bestrahlung ausgehärtet. Die Feinabstimmung aus Druckauflösung und Aushärtebedingungen ermöglichte die Reduktion interner Grenzflächen und den Druck vollständig transparenter, optisch homogener Glaskörper. Die Gläser wiesen Bruchfestigkeiten vergleichbar mit CR39 auf. Durch Anpassung des Druckdesigns jeder Einzellage gelang die Herstellung von Brillenglasformkörpern mit sehr hoher geometrischer Genauigkeit, wie anvisiert. Der angestrebte Quadratische Mittenrauwert konnte mit 2,7 nm erreicht werden, im Gegensatz zu der angestrebten maximalen Rautiefe. Für die benötigte Krümmung der Brillengläser sind die einzelnen Schichtdicken aktuell noch zu dick und müssen durch weitere Verfahrensverbesserungen reduziert werden. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Die Ergebnisse zeigen die Möglichkeit, die konventionelle Fertigung von Brillengläsern durch den 3D-Druck zu ergänzen oder sogar zu ersetzen. Mittels additiver Fertigung werden Durchlaufzeiten und Fertigungskosten besonders bei der Herstellung individuell korrigierender Brillengläser für komplexe Fehlsichtigkeiten verringert werden können. Kleinstserienfertigungen und Losgrößen von 1 bei gleichbleibenden Prozesskosten können dann wirtschaftlich werden. Durch weitere Entwicklungen, z. B. die Implementierung einer UV-Schutzbeschichtung, kann der Einsatz der additiven Brillenglasherstellung ausgebaut und der wirtschaftliche Vorteil erhöht werden.<br /> <br /> Die entwickelten Materialien für die Volumenkörper eignen sich aufgrund ihrer sehr guten optischen Eigenschaften für verschiedenste optische Komponenten, z. B. für gedruckte (und auch gegossene) Lichtwellenleiter, Linsen- oder Prismen. Die Materialien der Kratzfestbeschichtung ermöglichen zudem Änderungen der tribologischen Eigenschaften der Oberflächen. Sie sind damit nicht nur für verschiedenste Optiken, sondern auch außerhalb der Optik verwendbar. Der angepasste Tintenstrahldruck lässt sich aufgrund der Flexibilität des Verfahrens leicht zur Herstellung verschiedener bzw. wechselnder Optiken adaptieren. So ist der Tintenstrahldruck von Abbildungs- und Beleuchtungsoptiken verschiedener Formen und Größen und sogar smarten optischen Systemen möglich. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong><strong>einrichtung</strong>en</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Jena</li> <li>Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg</li> <li>Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymer-forschung IAP, Potsdam</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Carl Zeiss Meditec AG</li> <li>Carl Zeiss Vision International GmbH</li> <li>Deutsche Augenoptik AG</li> <li>die12monate GbR <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Eschenbach Optik GmbH</li> <li>micro resist technology GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>nanofluor GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Nanogate SE</li> <li>Notion Systems GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>OSA Opto Light GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Panta Rhei gGmbH</li> <li>polyoptics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Rodenstock GmbH</li> <li>Silhouette AG</li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Carl Zeiss Meditec AG, Carl Zeiss Vision International GmbH, die12monate GbR, Eschenbach Optik GmbH, micro resist technology GmbH, Nanogate SE, Notion Systems GmbH, Rodenstock GmbH, Silhouette AG und Panta Rhei gGmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 20750 BG der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 783.920 EUR</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1941"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 10.12.2021 (Webkonferenz)<br /> - 13.04.2021 (Webkonferenz)<br /> - 07.10.2020 (Webkonferenz)<br /> - 19.09.2019 (Fraunhofer IOF, Jena)</li> <li><strong>Zwischenberichte</strong><br /> - Zwischenbericht für 2020<br /> - Zwischenbericht für 2019</li> <li><strong>Posterpräsentationen</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul> |
|
HyoptO
Hybridfertigung optischer Oberflächen
|
(2018-2021)
|
F.O.
|
|
Oberflächen-Funktionalisierung7
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 20308 N (2018 - 2021)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Die Bearbeitung optischer Oberflächen mit komplexen Geometrien (Asphären und Freiformflächen) wird konventionell im Punktkontakt mit immer feiner werdender Abstufung der Schleif- und Polierprozesse durchgeführt. Diese Abstufung der Prozessschritte ist notwendig, um eine defektfreie glatte Oberfläche zu erhalten, führt jedoch zu langen Bearbeitungszeiten und hohen Prozesskosten. Alternative Verfahren wie das Präzisionsblankpressen sind bisher auf hohe Stückzahlen, pressbare Formen und wenige pressbare Materialien beschränkt. Entwicklungen von Laseranwendungen in der Optikfertigung zeigen großes Potential im Hinblick auf Prozessgeschwindigkeiten und -ergebnisse. So kann beim sogenannten Laserpolieren das Glasmaterial an der Oberfläche aufgeschmolzen und durch die Oberflächenspannung abtragfrei geglättet werden. Hierbei werden geometrieunabhängig Bearbeitungszeiten von nur 1 bis 5 s/cm<sup>²</sup> erreicht. Die erreichbare Mikrorauheit (λ < 80 µm) liegt dabei bereits unter der einer konventionellen mechanischen Politur. Der reine Laserpoliturprozess ist jedoch durch eine unzureichende Glättung mittelfrequenter Rauheiten (λ > 100 µm) und Beeinträchtigung der Formgenauigkeit behaftet, sodass die Vorteile der Laserpolitur bisher nicht genutzt werden.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des IGF-Vorhabens HyoptO war die Entwicklung einer hybriden Prozesskette, um die geforderten Qualitäten optischer Oberflächen in deutlich verkürzten Bearbeitungszeiten zu erreichen. Durch die Kombination konventioneller Fertigungsschritte und der Laserpolitur sollten die Vorteile der Laserpolitur (Ausheilung von Tiefenschädigungen, Geometrieunabhängigkeit, hohe Prozessgeschwindigkeit) genutzt und die Nachteile (unzureichende Glättung mittelfrequenter Fehler (MSFE), thermischer Formverzug) umgangen werden können. Hierfür sollten zunächst geeignete Schnittstellen der zu kombinierenden Verfahrenstechniken ermittelt und die Bearbeitungsparameter beider Verfahren optimiert werden. Schließlich sollte die Hybrid-Prozesskette auf die erzielbaren Oberflächenqualitäten und die Wirtschaftlichkeit hin untersucht werden.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Zunächst wurden die Schnittstellen der Prozesskette untersucht und die einzelnen Prozessschritte aufeinander abgestimmt. Die Auswirkungen der Laserpolitur auf das Substrat hinsichtlich optischer Eigenschaften und Eliminierung der Schädigungen aus der vorausgegangenen Schleifbearbeitung wurde anhand der Glassorten Quarzglas, N-BK7, N-SF6 und S-FPL53 untersucht. Darauf aufbauend konnte eine Hybrid-Prozesskette, bestehend aus (1) mechanischem Schleifen, (2) Laserpolieren und (3) mechanischer Korrekturpolitur, für die Fertigung von Optiken entwickelt werden.<br /> <br /> Mit der Laserpolitur konnten die beim Schleifen von Glas entstehenden Oberflächenfehler (SSD) auch in Tiefen bis zu mehreren 100 µm zuverlässig ausgeheilt und die Rauheit der Flächen gleichzeitig deutlich reduziert werden. Dadurch erübrigen sich langwierige konventionelle Politurschritte zum Abtrag SSD-durchsetzter Oberflächenschichten.<br /> <br /> Allerdings ergaben sich bei der Laserpolitur auch ungewollte Begleiterscheinungen: Beim Schleifen entstandene mittelfrequente Oberflächenfehler (MSFE) auf Quarzglas können mithilfe der Laserpolitur nicht vollständig geglättet werden und sind in einem zusätzlichen Glättschritt vor der Korrekturpolitur zu beseitigen. Für andere Glassorten (z. B. N-BK7, N-SF6) konnte hingegen ein Prozessfenster identifiziert werden, in dem MSFE während der Laserpolitur vollständig geglättet werden.<br /> <br /> Eine weitere mögliche Begleiterscheinung des Laserpolierens ist ein Verzug der Bauteile durch die Wärmeeinwirkung. Während für Quarzglas dieser Formverzug in der Größenordnung des Fehlers nach dem Schleifen liegt, kann in anderen Glassorten ein viel größerer Formfehler entstehen, der einen erheblichen Aufwand bei der Korrekturpolitur verursachen kann. Durch optimierte Schleifparameter kann der Formfehler jedoch vorgehalten und so der Korrekturaufwand signifikant reduziert werden.<br /> <br /> Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zeigte, dass die Hybrid-Prozesskette konventionelle Fertigungstechniken für Planflächen oder Sphären nicht ersetzen kann. Bei der Fertigung von Asphären oder Freiformflächen ergibt sich jedoch ein wirtschaftlicher Vorteil, der mit zunehmender Optikgröße, Komplexität der Geometrie und Individualisierung wächst.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Die in HyoptO erarbeiteten Ergebnisse zeigen die wirtschaftliche Integrierbarkeit der Laserpolitur in die Optikfertigung. Insbesondere für komplexe Optikgeometrien können hierdurch Durchlaufzeiten und Fertigungskosten verringert werden. Durch weitere Entwicklungen, z. B. bei der Reduktion von MSFE in Quarzglas vor und nach der Laserpolitur, kann der wirtschaftliche Vorteil des Hybrid-Prozesses weiter gesteigert werden. Weiteres Potenzial liegt in der Erweiterung der Anwendbarkeit der Laserpolitur auf großdimensionale Optiken (Ø > 100 mm) und bedient so ein wichtiges Nischensegment der mittelständisch geprägten deutschen Optikbranche.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong><strong>einrichtung</strong>en</strong></p>
<ul> <li>Technische Hochschule Deggendorf, Institut für Präzisionsbearbeitung und Hochfrequenztechnik</li> <li>Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>ASA Astrosysteme GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>asphericon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Berliner Glas GmbH</li> <li>Carl Zeiss Jena GmbH</li> <li>GFH GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Jenoptik Optical Systems GmbH</li> <li>LASER COMPONENTS Germany GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LAYERTEC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Leica Camera AG</li> <li>Leica Microsystems GmbH</li> <li>Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>Sill Optics GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen asphericon GmbH, Jenoptik Optical Systems GmbH, LASER COMPONENTS Germany GmbH, LAYERTEC GmbH, Leica Camera AG, Leica Microsystems GmbH und Sill Optics GmbH & Co. KG an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 20308 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 434.510 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li>Trum C, Jung M, Schmidbauer B, Sitzberger S, Willenborg E, Rascher R. Hybrid-process-chain for polishing optical glass lenses – HyoptO. <em>Proc SPIE 11487</em>, <strong>2020</strong>; Optical Manufacturing and Testing XIII, 114871L<a href="http://dx.doi.org/10.1117/12.2568400"> </a><a href="https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11487/2568400/Hybrid-process-chain-for-polishing-optical-glass-lenses--HyoptO/10.1117/12.2568400.short?tab=ArticleLink">DOI: 10.1117/12.2568400</a></li> <li>Jung M, Trum C, Schmidbauer B, Willenborg E, Rascher R. Non-ablative removal of sub surface damages in ground optical glass substrates by controlled melting of thin surface layers using CO2-laser radiation. <em>Proc. SPIE</em> <em>11478</em>, <strong>2020</strong>; Seventh European Seminar on Precision Optics Manufacturing <a href="https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11478/2564801/Non-ablative-removal-of-sub-surface-damages-in-ground-optical/10.1117/12.2564801.short">DOI: 10.1117/12.2564801</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1406"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 22.04.2021 (Webkonferenz)<br /> - 09.12.2020 (Webkonferenz)<br /> - 18.05.2020 (Webkonferenz)<br /> - 30.03.2020 (Technologiecampus, Teisnach)<br /> - 23.09.2019 (Wetzlarer Hof, Wetzlar)<br /> - 23.01.2019 (Fraunhofer ILT, Aachen)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2020<br /> - Zwischenbericht für 2018/2019</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 15. Juni 2023 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
ODIN
Osseodisintegration enossaler Implantate mit biophysikalischen Methoden
|
(2018-2022)
|
F.O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Oberflächen-Funktionalisierung7
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 20302 N (2018 - 2022)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Weltweit werden jährlich über 15 Millionen Dentalimplantate eingesetzt. Dabei werden 6-16 mm lange Schrauben im Kieferknochen (= enossal) fixiert, die anschließend irreversibel festwachsen (= Osseointegration) und so die notwendige Festigkeit erlangen, um Zahnersatzkonstruktionen tragen zu können. <br /> <br /> Allerdings können Komplikationen auftreten, z. B. bei Implantatbrüchen, Verschleiß mit daraus resultierenden Passungenauigkeiten, Entzündungen oder ästhetischen Problemen, sodass es notwendig oder sinnvoll ist, Implantate zu entfernen. Allerdings ist die Osseointegration bisher irreversibel. Zur Entfernung sind die Implantate aus dem Knochenlager herauszufräsen, was erhebliche Knochendefekte um das Implantatbett herum verursacht. Dies verschlechtert jedoch die Möglichkeiten einer implantologischen Neuversorgung erheblich. <br /> <br /> Ein gewebeschonendes Verfahren zur Osseodisintegration, also zur Lösung von Dentalimplantaten von den mit ihnen verwachsenen Knochenzellen, wäre ein Meilenstein in der Implantologie. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel war die Entwicklung eines innovativen Verfahrens zur atraumatischen Osseodisintegration enossaler Dentalimplantate. Der von ODIN verfolgte Ansatz beruhte auf einer intentionellen Lösung der strukturellen und funktionellen Verbindung zwischen Knochenzellen und Implantat durch kontrollierte Einbringung optimierter thermischer Impulse und homogener Temperatur-Ausbreitung. <br /> <br /> Idealerweise kann eine für die effektive Lösung der Verbindung notwendige Erwärmung oder Kühlung räumlich eng auf den Bereich entlang der Implantat/Knochenzellen-Grenzfläche begrenzt werden. Durch eine dieserart erzielbare Reversibilität der Osseointegration sollen Implantate mit geringen Kräften herausgeschraubt werden können, ohne mehr als eine < 0,5 mm dünne Knochenschicht an der Grenzfläche zum Implantat zu denaturieren.<br /> <br /> Die Innovationsentwicklung bedurfte einer Methodik zur gezielten Temperierung, numerische und experimentelle Untersuchungen bzgl. des thermischen Einflusses entlang der Grenzflächen, In-vivo-Verifizierung an Tiermodellen sowie Standardisierung eines Verfahrens. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Es wurden drei Temperierungsmethoden entwickelt, eine elektrische Erwärmung mittels Heizelement, eine Laser-optische Erwärmung mittels Dentallaser und eine Erwärmung oder Kühlung durch erzwungene Konvektion (s. Abb. unten). Der thermische Einfluss auf die Verbindungsfläche Implantat/Knochen wurde für die genannten Temperierungsmethoden zunächst artunspezifisch, dann ex vivo an realen Implantaten in Schweinekiefern und in vivo an Implantaten in Kleintieren (Ratten) und Großtieren (Schweinen) untersucht.<br /> <br /> In dem Projekt konnte eine gleichmäßige, lokal begrenzte und damit schonende Temperierung der gängigsten Zahnimplantate erreicht werden. Dadurch konnten thermische Schädigungen von Knochen außerhalb einer < 0,5 mm dünnen Knochenschicht an der Grenzfläche zum Implantat vermieden werden. Innerhalb dieser Knochenschicht hingegen stellten sich bei denselben Temperierungsbedingungen Anzeichen für die beabsichtigte Osseodisintegration ein: Bei In-vivo-Untersuchungen an Ratten konnten mit dem Transmissionselektronenmikroskop Zellschäden in der direkten Implantatumgebung nachgewiesen werden, unabhängig von der gewählten Temperierungsmethode. Unter anderem kam es zur Schrumpfung und Ablösung von der umgebenden Knochenmatrix, teilweise zu nekrotischen Zellen, die leere Ausbuchtungen ("Lakunen") hinterließen. <br /> <br /> Es konnte ein ideales Temperaturfenster für die Osseodisintegration der Implantate identifiziert werden, bei dem das Implantat eine Temperatur von 50 °C erreicht. Die besondere Eignung dieses Temperaturfensters wurde bei den Untersuchungen am Kleintiermodell bestätigt. Intensität und Dauer der Temperierung haben dabei einen signifikanten Einfluss auf die Homogenität der Temperaturverteilung an der Implantat/Knochen-Grenzfläche sowie an der Ausbreitung der Temperierung in den umgebenden Knochen. Eine höhere Heizleistung bei entsprechend kürzerer Aufheizzeit von z. B. < 2 Minuten führen zu einer inhomogeneren Temperaturverteilung auf der Implantatoberfläche, jedoch zu einer geringeren Penetrationstiefe der Temperierung in den Knochen und damit zu einer geringeren thermisch bedingten Knochennekrose. <br /> <br /> Die Versuche am In-vivo-Großtiermodell lieferten keine weitere Bestätigung der Ergebnisse, da die Implantate von den Tieren nicht angenommen und herausgebissen wurden. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Die Ergebnisse von ODIN tragen zur Entwicklung neuer Geräte zur Implantat-Entfernung und für andere Anwendungen bei. So profitieren vor allem kleinere Hersteller von thermischen Quellen für verschiedene Anwendungsnischen. Auch Zahnarztpraxen profitieren durch das neue Geschäftsfeld einer gewebeschonenden Implantatextraktion. Über diese KMU-Nutzen hinaus profitieren Implantathersteller beliebiger Größe von den erarbeiteten Auslegungsempfehlungen für Osseodisintegrationsgeeignete Implantat-Innengeometrien. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>RWTH Aachen, Lehrstuhl für Wärme- und Stoffübertragung</li> <li>RWTH Aachen, Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Akademie für zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe</li> <li>BEGO GmbH & Co. KG</li> <li>bredent med. GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Bürkert Werke GmbH & Co. KG</li> <li>CAMLOG Vertriebs GmbH</li> <li>Limmer Laser GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LLS ROWIAK GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Mectron Deutschland GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Medentika GmbH</li> <li>National Instruments GmbH</li> <li>RWTH Aachen, Klinik für Unfallchirurgie und Wiederherstellungschirurgie</li> <li>Schlumbohm GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Sirona Dental Systems GmbH</li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> <li>W & H Deutschland GmbH</li> <li>Zahnärzte Ayoub <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Zahnärzte am Kirchplatz Düsseldorf <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Zahnärztliche Praxis für Parodontolologie <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Bürkert Werke GmbH & Co. KG, LLS ROWIAK GmbH, Medentica GmbH sowie W & H Deutschland GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 20302 N der F.O.M. wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 492.448 EUR</li> </ul>
<p><strong>Deckung der Administrationskosten</strong></p>
<ul> <li>Eine Deckung der Administrationskosten durch freiwillige Förderbeiträge interessierter Industrieunternehmen wurde bei Weitem nicht erreicht. Von einer fortgesetzten Verfolgung der Projektidee im Rahmen der IGF über dieses Projekt hinaus muss die F.O.M. daher leider absehen.<br /> </li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li>Kniha K, Hermanns-Sachweh B, Al-Sibai F, Kneer R, Möhlhenrich SC, Heitzer M, Hölzle F, Modabber A. Effect of thermal osteonecrosis around implants in the rat tibia: numerical and histomorphometric results in context of implant removal.<em> Sci Rep</em>, <strong>2022</strong>; Dec 23;12(1):22227. <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36564495/">DOI: 10.1038/s41598-022-25581-9</a></li> <li>Kniha K, Hölzle F, Al-Sibai F, Jörg J, Kneer R, Modabber A. Heat Analysis of Different Devices for Thermo-explantation of Dental Implants: A Numeric Analysis and Preclinical In Vitro Model. <em>J Oral Implantol.</em> <strong>2021</strong>; Dec 1;47(6):455-463. <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33270868/">DOI: 10.1563/aaid-joi-D-20-00046</a></li> <li>Kniha K, Buhl EM, Hermanns-Sachweh B, Al-Sibai F, Bock A, Peters F, Hölzle F, Modabber A. Implant removal using thermal necrosis—an in vitro pilot study. <em>Clin Oral Invest 25</em>, <strong>2021</strong>; 265–273. DOI: <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-020-03361-x">10.1007/s00784-020-03361</a></li> <li>Winnen RG, Kniha K, Modabber A, Al-Sibai F, Braun A, Kneer R, Hölzle F. Reversal of Osseointegration as a Novel Perspective for the Removal of Failed Dental Implants: A Review of Five Patented Methods. <em>Materials (Basel)</em>, <strong>2021</strong>; Dec 17;14(24):7829. <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34947422/">DOI: 10.3390/ma14247829</a></li> <li>Kniha K, Heussen N, Weber E, Möhlhenrich SC, Hölzle F, Modabber A. Temperature Threshold Values of Bone Necrosis for Thermo-Explantation of Dental Implants-A Systematic Review on Preclinical In Vivo Research. <em>Materials (Basel)</em>, <strong>2020</strong>; Aug 6;13(16):3461. <a href="https://www.mdpi.com/1996-1944/13/16/3461">DOI: 10.3390/ma13163461</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=2019"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen</strong><br /> - 19.05.2021 (Webkonferenz)<br /> - 09.11.2020 (Webkonferenz)<br /> - 17.09.2019 (MKG RWTH, Aachen)<br /> - 29.11.2018 (WSA RWTH, Aachen)</li> <li><strong>Zwischenberichte</strong><br /> - Zwischenbericht für 2021<br /> - Zwischenbericht für 2020<br /> - Zwischenbericht für 2019<br /> - Zwischenbericht für 2018</li> <li><strong>Posterpräsentationen</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2022<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2021<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul> |
|
CellPulse
Zellmanipulation im Hochdurchsatz mittels gepulster Laser
|
(2018-2020)
|
F.O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Detektion, Diagnostik5
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 20134 N (2018 - 2020)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Eine präzise Zellmanipulation bietet für biomedizinische Applikationen vielfältiges Einsatzpotenzial. Neben der Zellaufreinigung ist vor allem eine Einbringung von Fremdsubstanzen (z. B. Xenobiotika, Nukleinsäuren, Peptide) in das Zytoplasma von Zielzellen von Interesse. Zudem könnte eine zellschonende, hochpräzise und insbesondere standardisierbare Methode der Zellmanipulation grundlegend zu zahlreichen neuartigen Anwendungen in der Biotechnologie und in der klinischen Praxis (hier vor allem in immunologischen Verfahren, Krebs-Immuntherapie und Stammzelltherapien) beitragen. Die gegenwärtig genutzten Techniken der Zellmanipulation beruhen allerdings meist auf mechanischen oder chemischen Prinzipien und sind oft durch einen hohen apparativen Aufwand, keine konstant hohe Effizienz, eine hohe Belastung der Zellen und/oder mangelnde Zellselektivität gekennzeichnet. Ein Verfahren, das bei hohem Durchsatz gleichzeitig hochspezifisch, standardisierbar und Substanzunabhängig für die Zellmanipulation verwendet werden kann, war bislang nicht in greifbarer Nähe.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des IGF-Vorhabens CellPulse war die transiente Permeabilisierung von Säugerzellen im Hochdurchsatz mithilfe von einzelnen Sub-Nanosekunden-Laserpulsen ohne Applikation exogener Absorber.<br /> <br /> In einem experimentellen Aufbau am Lichtmikroskop sollten unter Verwendung eines Nd:YVO<sub>4</sub>-Lasers die Parameter Pulsenergie, Energiedichte, Rayleighlänge (Abstand zum Fokus, in dem sich die Strahlquerschnittsfläche verdoppelt) und Fokuslage (in Relation zur Zelle) variiert und hinsichtlich ihrer Effekte auf adhärent (auf Oberflächen) wachsenden Zielzellen bewertet werden. Das Ausmaß der transienten Zellpermeabilisierung unter Erhalt der Zellvitalität als Reaktion auf die Auslösung photophysikalischer Prozesse sollte durch den Substanztransfer in die Zellen bewertet werden. <br /> <br /> Basierend auf den optimierten Parametern für die transiente Manipulation immobilisierter Zellen sollte anschließend die flächige Zellpermeabilisierung erforscht werden. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Die verwendete Laserstrahlquelle, ein gütegeschalteter Nd:YVO<sub>4</sub>-Laser (die Pulse werden verkürzt und die Laserleistung während des Pulses erhöht), wurde in ein inverses Fluoreszenzmikroskop eingekoppelt. Die Fokussierung auf die Proben erfolgte mit dem Mikroskopobjektiv, das gleichzeitig zur visuellen Probenbetrachtung verwendet wurde. Entsprechend möglicher Zielanwendungen (Biotechnologie und Medizin) wurden die Säugerzelllinien CHO und THP-1 beschossen und die Parameter Pulsenergie, Energiedichte, Rayleighlänge und Fokuslage variiert. Als Nachweis der transienten Permeabiliserung vitaler Zellen wurde fluoreszenzmarkiertes Phalloidin und als Totfarbstoff Propidiumiodid verwendet. <br /> <br /> Während stark fokussierte Pulse mit hoher Energiedichte neben der Permeabilisierung einen starken Abtrag und die Elimination von Zellen bewirkten, konnten durch einen weniger stark fokussierten und gegenüber dem Zellrasen axial verschobenen Puls Abtrag und Elimination stark reduziert werden. Die Prozessierungsgeschwindigkeit zeigte sich als kritisch für den Permeabilisierungserfolg. Die Effizienz des Substanztransfers war dagegen weitgehend unempfindlich gegenüber geringfügigen axialen Fokusvariationen.<br /> <br /> Eine flächige Zellpermeabilisierung war also reproduzierbar unter weitgehender Vermeidung laserpulsinduziertem Zellabsterbens bei Fokussierung in den Zellkulturüberstand möglich. Dies ermöglicht einen zeitlich und räumlich kontrollierten Transport von Substanzen aus dem umgebenden Medium in die Zellen. Dabei ist eine zelllinienspezifische Optimierung der Bestrahlungsparameter empfehlenswert. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Die entwickelte Technologie kann in den Life Sciences, der in vitro Diagnostik, Wirkstoffforschung und in therapeutischen Verfahren in der Human- und Veterinärmedizin eingesetzt werden. KMU, mit meist geringen Forschungsetats, können das Verfahren in bestehende Geräte zur Hochdurchsatz-Zellbeobachtung und vergleichbare automatisierte Mikroskope oder High Content Screening Systeme implementieren. Dadurch erfahren die Systeme eine substanzielle Applikationserweiterung und stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.<br /> <br /> In zukunftsweisenden Technologien wie Organ-on-Chip eröffnet die Technologie die Möglichkeit, Zellen in ihrem Gewebeverband zielgerichtet zu manipulieren. Dadurch werden sowohl in der in vitro Diagnostik als auch in der Wirkstoffforschung neue Verfahren möglich, von denen KMU profitieren können. Applikationsbegleitend ist zu erwarten, dass neue diagnostische Tests für den Erfolg der Zellmanipulationen entwickelt und vertrieben werden können.<br /> <br /> Bei der Manipulation von Immunzellen im Rahmen von therapeutischen Verfahren, wie der (Tumor)vakzinierung, könnte das Verfahren für den reproduzierbaren Transfer von Molekülen in das Zytoplasma antigenpräsentierender Zellen ex vivo verwendet werden, was die Standardisierung und damit die Zulassungschancen erheblich verbessern kann. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik an der Universität Ulm</li> </ul>
<p><strong>AiF-Forschungsvereinigungen</strong></p>
<ul> <li>Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik</li> <li>DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Coherent LaserSyst. GmbH & Co. KG</li> <li>FISBA AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>GenID GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Hellma GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>InSCREENeX GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Labor Dr. Merk und Kollegen GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>MicroMol GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>PANTEC Deutschland GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> <li>TissUse GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Coherent LaserSyst. GmbH & Co. KG, FISBA AG, GenID GmbH, Hellma GmbH & Co. KG und PANTEC Deutschland GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 20134 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 249.620 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1136" target="_blank" title="Projektsteckbrief CellPulse">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2024" target="_blank" title="Projektplan CellPulse">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li>Hausladen F, Kruse P, Hessenberger F, Stegmayer T, Kao Y-T, Seelert W,Preyer R, Springer M, Stock K, Wittig R. Molecule transfer into mammalian cells by single sub-nanosecond laser pulses. <em>J Biophotonics</em>,<strong> 2023</strong>; e202200327. <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jbio.202200327">DOI: 10.1002/jbio.202200327</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1364"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 23.11.2020 (Webkonferenz)<br /> - 08.07.2020 (Webkonferenz)<br /> - 15.05.2019 (ILM, Ulm)<br /> - 05.07.2018 (ILM, Ulm)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2019<br /> - Zwischenbericht für 2018</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul> |
|
OptMetGlas
Laser-Strahlschmelzen metallischer Gläser – Optimierung von Werkstoff und Herstellungsverfahren
|
(2018-2020)
|
F.O.
|
|
Hochtechnologie Materialien8
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Sonstige Metathemen13
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 19927 N (2018 - 2020)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Aufgrund ihrer Amorphität besitzen metallische Gläser einzigartige mechanische Eigenschaften. Je nach Zusammensetzung können sie dadurch elastisch sein bei gleichzeitig hoher Härte und Festigkeit. Sie sind daher als Konstruktionswerkstoff höchst interessant. Die Bauteildimensionen sind jedoch bei der Verarbeitung durch konventionelle gusstechnische Fertigungsverfahren auf wenige Zentimeter begrenzt.<br /> <br /> Ein neues alternatives Herstellungsverfahren ist die additive Fertigung (AF) metallischer Gläser. Untersuchungen zur Qualifizierung von Prozessparametern und Charakterisierung thermo-physikalischer sowie mechanisch-technologischer Eigenschaften solch additiv gefertigter Gläser erfordern einen hohen zeitlichen Versuchsaufwand und werden für die industrielle Erschließung benötigt. Gerade KMUs, welche über die Anlagentechnik für die additive Fertigung verfügen, haben in der Regel nicht die Möglichkeit, diese Maschinen für Versuchsreihen aus dem Fertigungsbetrieb zu entnehmen.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Additive Laser-Strahlschmelzverfahren verfügen über das Potenzial, größere und komplexere Bauteile aus metallischem Glas herzustellen. Ziel des Vorhabens OptMetGlas war die Entwicklung geeigneter Prozessführungen zur additiven Verarbeitung metallischer Gläser im Laser-Strahlschmelzprozess. Durch prozess- und legierungsseitige Optimierungen des Werkstoffes sollten die herausragenden Materialeigenschaften der additiv-gefertigten metallischen Gläser für die breite industrielle Anwendung erschlossen werden.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Am Beispiel der Zr-basierten Legierung AMZ4 konnte gezeigt werden, dass die herstellbare Größe (im Gussverfahren ca. 12 mm Durchmesser) durch die Verwendung der additiven Fertigungstechnik nahezu beliebig gesteigert werden kann. Innerhalb der Untersuchungen wurden neue Strategien erarbeitet um defektarme Probekörper und endkonturnahe Demonstratorbauteile mit einer geringen Porosität (< 0,5 %) und amorpher Mikrostruktur herzustellen. Darüber hinaus wurden materialseitige Einflüsse auf die Defektausprägung und die resultierenden mechanisch-technologischen Eigenschaften ermittelt. Die hergestellten Probekörper zeigen eine hohe Festigkeit, gepaart mit einer hohen elastischen Dehngrenze oberhalb von 2 %, woraus Potenziale für Applikationen in hochbelastete nachgiebige Systeme und aufgrund der geometrischen Freiheitsgrade im Leichtbau entstehen.<br /> <br /> Nachbehandelte Flächen ohne Pulveranhaftungen weisen eine gute Eignung für medizintechnische Anwendungen hinsichtlich ihrer Korrosionsbeständigkeit auf. Anders als die gegossenen AMZ4-Probekörper, zeigen additiv gefertigte metallische Gläser keine plastische Verformung, was auf die gesteigerte Sauerstoffkontamination innerhalb der Prozesskette zurückzuführen ist. Die Sauerstoffkontamination hat entscheidenden Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften und ungewollte Kristallisationserscheinungen, eine Minimierung des Sauerstoffgehaltes im Pulver und in der Prozessumgebung ist daher anzustreben. Im Gegensatz zu kristallinen Materialien weisen metallische Gläser keine ausgeprägte Anisotropie nach dem Prozess auf. Anhand der entwickelten Prozessparameter können amorphe Bauteile aus AMZ4 im Laser-Strahlschmelzverfahren hergestellt oder Prozessführungen für andere Anlagensysteme abgeleitet werden.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Die gewonnenen Ergebnisse ermöglichen die Verarbeitung metallischer Gläser auf Zr-Basis insbesondere der Legierung AMZ4 mit Hilfe von Laser-Strahlschmelzanlagen. Auf Basis der entwickelten Parameterfenster, können die Prozessstrategien auch mit verhältnismäßig geringem Versuchsaufwand auf andere Anlagensysteme übertragen werden und verkürzen damit Prozessentwicklungszeiten und die finanzielle Einstiegshürde für AF-Dienstleister. Außerdem werden massive Bauteile aus metallischen Gläsern in Größen herstellbar sein, die schmelzmetallurgisch bisher nicht realisiert werden konnten.<br /> <br /> Die Werkstoffe sind somit sehr speziell, sodass sie auf dem Markt nicht durch große Unternehmen oder Konzerne angeboten werden können. Daraus ergibt sich eine hohe wirtschaftliche Relevanz speziell für KMUs, die den Markt der additiven Lohnfertigung dominieren. Neue Anwendungen der metallischen Gläser können entstehen, die vermutlich die Gründung einer Reihe von Start-Up-Unternehmen nach sich ziehen werden.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Universität Duisburg-Essen, Institut für Produkt Engineering, Lehrstuhl Fertigungstechnik</li> <li>Universität des Saarlandes, Lehrstuhl f. Metallische Werkstoffe</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>3D MicroPrint GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Add. Manufact. & Research UG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Additive Works GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Citim GmbH</li> <li>Electro Optical Systems</li> <li>Günter-Köhler-Inst. ifw</li> <li>Heraeus Deutschl. GmbH & Co. KG</li> <li>LaserTeck GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Linde AG</li> <li>MBFZ-toolcraft GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Meyer Brillenmanufaktur GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>MK Metallfolien GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Olympus Surgical Techn. Europe</li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen 3D MicroPrint GmbH, Add. Manufact. & Research UG, Heraeus Deutschl. GmbH & Co. KG, Linde AG, MBFZ-toolcraft GmbH, Meyer Brillenmanufaktur GmbH, MK Metallfolien GmbH und Olympus Surgical Techn. Europe an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 19927 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 346.660 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1132" target="_blank" title="Projektsteckbrief OptMetGlas">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2027">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li>Tillmann, W., Fehr, A., Wegner, J., Stangier, D., Kleszczynski, S., Witt, G., LPBF-M manufactured Zr-based bulk metallic glasses coated with magnetron sputtered ZrN films. <em>Surface and Coatings Technology </em><strong>2020</strong>, 386: 125463. DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.125463">10.1016/j.surfcoat.2020.125463</a></li> <li>Wegner, J., Frey, M., Kleszczynski, S., Busch, R., Witt, G., Influence of process gas during powder bed fusion with laser beam of Zr-based bulk metallic glasses.<em> Procedia CIRP</em>, <strong>2020</strong>, 94: 205–210. DOI: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827120312245">10.1016/j.procir.2020.09.039</a></li> <li>Wegner, J., Frey, M., Stiglmair, P., Kleszczynski, S., Witt, G., Busch, R.,<em> </em>Mechanical Properties of Honeycomb structured Zr-based bulk metallic glass specimens fabricated by laser powder bed fusion. <em>South African Journal of Industrial engineering</em> <strong>2019</strong>, 30(3): 32–40. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.7166/30-3-2265">10.7166/30-3-2265</a></li> <li>„Additive Fertigung – 3-D-Druckverfahren sind Realität in der industriellen Fertigung“ <a href="https://www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/3-d-druckverfahren-sind-realitaet-in-der-industriellen-fertigung">VDI Statusreport <strong>2019</strong></a></li> </ul>
<p><strong>Akademische Abschlussarbeiten</strong></p>
<ul> <li class="MsoPlainText">Wang, W. (2020): "Einflüsse auf die Defektausprägung in überhängenden Geometrien Zr-basierter metallischer Gläser im LPBF-Verfahren" (Masterarbeit)</li> <li>Zeymer, J. (2020): "Laser-Strahlschmelzen auxetischer Strukturen aus Zr-basiertem metallischen Glas" (Masterarbeit)</li> <li>Henkemeier, T. (2020): "Verschleißverhalten additiv gefertigter Zr-basierter metallischer Gläser" (Bachelorarbeit)</li> <li>Materna, L. (2020): "Konzeptionierung und Inbetriebnahme einer modularen Bauraumverkleinerung für den Laser-Strahlschmelzprozess" (Bachelorarbeit)</li> <li>Pieper, L. (2019): "Additive Fertigung anwendungsnaher Demonstratorgeometrien aus AMZ4 im Laser-Strahlschmelzverfahren" (Masterarbeit)</li> <li>Bäcker, J. (2019): "Einfluss der Belichtungsstrategien zur Herstellung kritischer Geometrieelemente bei der Verarbeitung metallischer Gläser mittels Laser-Strahlschmelzen" (Masterarbeit)</li> <li>Vrbanic, D. (2019): "Parameterstudie zur Verarbeitung metallischer Gläser auf Zirkonium-Basis im Laser-Strahlschmelzprozess" (Bachelorarbeit)</li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1244"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 30.03.2020 (Webkonferenz)<br /> - 20.11.2019 (Messe FormNext, Frankfurt)<br /> - 27.06.2019 (Messe RapidTech, Erfurt)<br /> - 15.11.2018 (Messe FormNext, Frankfurt)<br /> - 06.06.2018 (Messe RapidTech, Erfurt)</li> <li><strong>Zwischenbericht:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2019<br /> - Zwischenbericht für 2018</li> <li><strong>Posterpräsentation:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul> |
|
DIAS
Strukturierte CVD-Diamant-Mikroschleifstifte
|
(2017-2020)
|
F.O.
|
|
Oberflächen-Funktionalisierung7
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 19664 N (2017 - 2020)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Mikroschleifstifte werden heute in vielen Branchen zur Herstellung von Mikro- und Präzisionsbauteilen benötigt. Der Trend zu Miniaturisierung und Leistungssteigerung sowie die damit verbundenen steigenden Qualitätsanforderungen erfordern in stark zunehmendem Maße die Herstellung und Bearbeitung von Strukturen mit immer kleineren Abmessungen. Die heute verfügbaren Schleifstifte sind allerdings bezüglich kleinstem Durchmesser und feiner Körnung limitiert.<br /> <br /> Schleifstifte mit mikrokristalliner CVD-Diamant-Beschichtung sind verschleißärmer und erlauben deutlich kleinere Stiftdurchmesser. Zudem verfügen sie über scharfkantigere Mikroeinzelschneiden in höherer Anzahl und sind sofort nach der Herstellung einsatzfähig. Aufgrund der glatten Oberflächen sind jedoch die Kühlmittelzufuhr und die Spanabfuhr gehemmt. Daher kommt es beim industriellen Einsatz zu Zusetzungen, die insbesondere bei sehr kleinen Stiftdurchmessern (< 1 mm) zum Werkzeugbruch führen können. Weitere mögliche Ursachen für einen Werkzeugbruch sind zu hohe Abweichungen des Rundlaufs (Gleichförmigkeit des Rundprofils in Rotation) und zu hohe Zustellungen beim Schleifprozess sowie Unwuchten der hochtourig betriebenen Schleifspindeln. <br /> <br /> Leistungsfähige Schleifstifte mit kleinsten Stiftdurchmessern und Körnung sind derzeit nicht verfügbar. Zudem fehlen wirkungsvolle Instrumente, um konstante Prozessbedingungen zu ermöglichen. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des Projekts DIAS war die Entwicklung leistungsfähiger CVD-Diamant-Schleifstifte mit 0,1-3,0 mm Durchmesser und hoher Stabilität und Reproduzierbarkeit. Hierzu wurden Span- und Kühlschmierstoff-Transportgeometrien durch Schleifen der Grundkörper und anschließendem Beschichten sowie durch Laserstrukturierung der CVD-Diamantschicht in den Schleifstift eingebracht, um Zusetzungen zu vermeiden und höhere Zeitspanungsvolumina zu ermöglichen. Für eine optimierte Prozessüberwachung wurde ein Körperschallsensor zur Anschnitterkennung eingesetzt und der Rundlauf mittels Lasertriangulation ermittelt.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Um auch Schleifstifte mit Durchmessern ≤ 0,5 mm vor der CVD-Diamantbeschichtung ohne Bruchgefahr vorbehandeln zu können, wurde auf das sonst übliche Sandstrahlen der Hartmetallrohlinge verzichtet und die Vorbehandlung basierend auf Cobaltätze optimiert, sodass eine anwendungsgerechte Schichthaftung sichergestellt werden konnte. Durch Anpassung der Prozessparameter und Optimierung der Chargierung im Beschichtungsprozess konnten Werkzeuge mit unterschiedlichen Durchmessern und Nutgeometrien uniform und konturgetreu beschichtet werden. Auf den CVD-Diamantschleifbelägen wurde keine besondere Klebneigung der Späne festgestellt. <br /> <br /> Für Schleifstifte mit Durchmessern von 0,2-3,0 mm wurden zwei Strukturierungskonzepte erfolgreich umgesetzt: Das schleiftechnische Einbringen von Spiralnuten in den Hartmetallgrundkörper vor der Diamantbeschichtung sowie die nachträgliche Strukturierung der Diamantschichten mittels Laserbearbeitung. Mit der Grundkörperstrukturierung durch Schleifen wurden besonders gute Ergebnisse erzielt: Die eingebrachten Spiralnuten bewirkten eine signifikante Reduzierung der Schleifkräfte, woraus eine geringere Werkzeugabdrängung und eine gesteigerte Präzision der Bearbeitung resultiert. Durch eine verbesserte Kühlschmierstoffzufuhr erhöht die Strukturierung gleichzeitig die Lebensdauer von CVD-Diamantschleifstiften auf das 2,5-fache von konventionellen Diamantschleifstiften, bei einer gleichzeitig um 40 % reduzierten Rautiefe. Die nachträgliche Laserstrukturierung führte dagegen bei Praxistests bisher noch zur Destabilisierung (und Delamination) der Diamantschicht. <br /> <br /> Erstmals konnten auch CVD-Diamantschleifstifte aus Siliziumnitrid-Grundkörpern hergestellt werden, die mittels Laserbearbeitung der Diamantschicht strukturiert und erfolgreich im Labor sowie bei beteiligten KMU getestet wurden. Zudem wurde eine optimierte Prozessüberwachung aufgebaut, die sichere und reproduzierbare Prozesse ermöglicht. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Zunehmend werden Bauteile aus Keramik und Hartmetall hergestellt. Diese lassen sich wirtschaftlich nur mit Diamantschneidstoffen zerspanen. Insbesondere durch die vielfältigen Vorteile der neu entwickelten CVD-Diamantschleifwerkzeuge profitieren die mittelständisch geprägten Branchen der Präzisionswerkzeughersteller, CVD-Diamantbeschichter und Hersteller von Mikro- und Präzisionsbauteilen. Hier können strukturierte Mikroschleifstifte z. B. bei der Herstellung von Glasküvetten, der Fertigung von optischen Oberflächen, dem Schleifen von Linsenformen für Linsenarrays aus Glas, der Präzisionsbearbeitung von Einspritzsystemen der Automobilindustrie sowie in der Medizintechnik und Halbleiter-Industrie Anwendung finden und können dabei helfen, dem Trend zu Miniaturisierungen und steigenden Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Die neuen Werkzeuge tragen somit dazu bei, Produktionskosten zu senken und bestehende Geschäftsfelder zu sichern und zu erweitern.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, Braunschweig</li> <li>Technische Universität Braunschweig, Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik IWF</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Bangerter Microtechnik AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>GD Optical Competence GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>GMN GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Hellma GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Laserpluss AG</li> <li>Meister Abrasives AG</li> <li>Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH</li> <li>Robert Bosch GmbH</li> <li>Schleifscheibenfabrik Alfons Schmeier GmbH & Co. KG</li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> <li>Wilhelm Bahmüller GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Bangerter Microtechnik AG, GD Optical Competence GmbH, GMN GmbH & Co. KG, Hellma GmbH & Co. KG, Laserpluss AG, Meister Abrasives AG, Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH, Robert Bosch GmbH und Wilhelm Bahmüller GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 19664 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 500.750 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1142" target="_blank" title="Projektsteckbrief DIAS">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2035" target="_blank" title="DIAS Projektplan">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li><span class="markedContent" id="page195R_mcid21"><span class="markedContent">Baron S, Tounsi T, Gäbler J, Mahlfeld G, Stein C, Höfera M, Sittinger V, Hoffmeister H-W, Hermann C, Dröder K. Diamond Coating for advanced cutting tools in honing an grinding. <em>Procedia CIRP</em> <strong>2022</strong>, 108:589-594. DOI: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827122005558?via%3Dihub">10.1016/j.procir.2022.03.093</a></span></span></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1380"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 27.05.2020 (Webkonferenz)<br /> - 12.11.2019 (Rauschert Heinersdorf - Pressig GmbH, Stockheim/Neukenroth)<br /> - 09.05.2019 (Hellma GmbH & Co. KG, Müllheim)<br /> - 28.11.2018 (Schleifscheibenfabrik Alfons Schmeier GmbH & Co. KG, Helmbrechts)<br /> - 14.06.2018 (IWF, Braunschweig)<br /> - 13.11.2017 (Fraunhofer IST, Braunschweig)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2019<br /> - Zwischenbericht für 2018<br /> - Zwischenbericht für 2017</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul> |
|
HSI-plus
Strukturierte Beleuchtung und hyperspektrale Bildgebung als neuartiger Ansatz zur Tumorerkennung in der Dermatologie
|
(2017-2020)
|
F.O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
3D-Visualisierung, Monitoring4
Detektion, Diagnostik5
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 19639 N (2017 - 2020)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Bei Untersuchungen zur Hautkrebsfrüherkennung erfolgt die chirurgische Entnahme tumorverdächtigen Gewebes und dessen Analyse bisher meist nur auf Basis visueller Kontrollen und in Abhängigkeit von der Erfahrung der untersuchenden Ärzte. Dadurch wird häufig die rechtzeitige Entfernung bösartiger Melanome versäumt, während viele harmlose Muttermale herausoperiert werden. Die frühzeitige Erkennung von Melanomen und Exzision sind jedoch entscheidend für eine erfolgreiche Hautkrebsbehandlung.<br /> <br /> Ein System, welches den Arzt bei der (frühzeitigen) Erkennung von Hauttumoren unterstützt und auch dem unerfahrenen Allgemeinarzt ein Screening ermöglicht, existiert aktuell nicht, würde jedoch die Mortalität erheblich senken.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des Vorhabens HSI-plus war die Entwicklung eines bildgebenden Messsystems, das die objektive Erkennung prämaligner Läsionen der Haut ermöglicht.<br /> <br /> Hierzu wurden zwei Technologien kombiniert: Mit strukturierter Beleuchtung sollte eine Tiefenauflösung erreicht und störende Signale aus unteren Gewebeschichten herausgefiltert werden, sodass ein hyperspektrales Kamerasystem Zellveränderungen durch eine ortsaufgelöste Erfassung optischer Hauteigenschaften erkennen kann. Unter Berücksichtigung der Lichtausbreitung in der Probe sollte eine quantitative Bestimmung der Inhaltstoffe, wie z. B. des Melaningehalts in der Haut oder der Sauerstoffsättigung im Blut, ermöglicht werden, was bisher mit der in der Diagnostik und Messtechnik vielfältig eingesetzten, berührungslosen Methode – die optische Spektroskopie – nur mit aufwendigen Kalibrationsmessungen erreicht werden kann.<br /> <br /> Weiterhin sollte die Messung mit dem kombinierten System nicht nur an einem Punkt, sondern bildgebend und spektral aufgelöst an über 1000 Punkten gleichzeitig erfolgen, sodass das System in den industriellen, medizinischen und wissenschaftlichen Bereichen einsetzbar ist, in denen spektrometrische Systeme und/ oder Kamerasysteme verwendet werden.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Zusammen mit einer erfahrenen Dermatologin und den Unternehmen des Projektbegleitenden Ausschusses wurden zu Projektbeginn Anforderungen an das zu entwickelnde Bildgebungsverfahren definiert – z. B. ein Spektralbereich von 490-980 nm sowie eine Spezifität und Sensitivität > 90 % – auf deren Basis verschiedene Laborsysteme aufgebaut wurden.<br /> <br /> Ein Laboraufbau bestehend aus einem Messsystem mit Schwarz-Weißkamera und strukturierter multispektraler Beleuchtung über LEDs wurde aufgrund hoher Empfindlichkeit, kurzer Messdauer und gutem Signal-Rausch-Verhältnis zu einem Demonstrator entwickelt.<br /> <br /> In dem Funktionsdemonstrator wurde das Licht von neun farbigen LEDs eingekoppelt, die gemeinsam auf einen Glasstab zur Farbmischung aufgesetzt wurden. Unmittelbar nach dem Stabende befindet sich ein umlaufendes Filterrad mit fünf verschiedenen Streifenmustern, die, ähnlich einem Diaprojektor, sequentiell auf die Hautoberfläche abgebildet werden. Nach jedem Umlauf wird eine andere LED-Farbe eingeschaltet und so eine sequentielle multispektrale Bilderfassung mit neun Farben und fünf Streifenmustern realisiert.<br /> <br /> Die maximale Strahlungsleistung beträgt < 36 mW/cm<sup>2</sup> in 2 cm Entfernung zum Messsystem, womit das Messgerät nach EU-Norm 270106 für künstliche optische Strahlung Augen- und Hautsicher ist. Die relative Abweichung zur Referenz (Absorption und reduzierter Streukoeffizient) liegt im gesamten Messbereich knapp unter 10 % und somit innerhalb der ursprünglich definierten Genauigkeit.<br /> <br /> Erwartungsgemäß konnte mit dem Messsystem der dunklere Nävus über einen höheren Absorptionskoeffizienten über den gesamten sichtbaren Spektralbereich deutlich abgebildet werden.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Neben der Früherkennung von Melanomen kann das Messsystem für weitere medizinische Anwendungen, wie die Erkennung anderer Tumorarten und Gewebeveränderungen genutzt werden. Ebenso sind die Aussichten der Einsetzbarkeit des Messsystems in vielfältigen, anderen Branchen enorm, wie z. B. in der Lebensmittelkontrolle, in der Pharmazie, Papier- und Textilindustrie, in der Mülltrennung, im Bereich der Computergrafik oder im Homecare-Bereich. Die Anpassung der im Projekt entwickelten Methoden und Komponenten an Fragestellungen in diesen Branchen ist mit geringem Investitionsaufwand möglich. Damit eignet sich das System insbesondere für KMU und für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.</p>
<p>Das IGF-Projekt HSI-plus wurde mit dem <a href="https://www.forschung-fom.de/transfer/preise-und-nominierungen" target="_blank" title="Otto von Guericke-Preis">Otto von Guericke-Preis</a> ausgezeichnet und damit zum IGF-Projekt des Jahres 2020 gekürt.</p><p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong>einrichtung</strong></p>
<ul> <li>Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik an der Universität Ulm</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Berliner Glas KGaA</li> <li>Carl Zeiss Optotechnik GmbH</li> <li>Cubert GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>DIOPTIC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>IBL GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>inno-spec GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Inst. f. Textilchemie & Chemiefasern</li> <li>LASER COMPONENTS Germany GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Optis GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>POG Präzisionsoptik Gera GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Richard Wolf GmbH</li> <li>Simeon Medical GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SPECTARIS, Dt. Industrieverband</li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Berliner Glas KGaA, Carl Zeiss Optotechnik GmbH, DIOPTIC GmbH, inno-spec GmbH, LASER COMPONENTS Germany GmbH, Optis GmbH, POG Präzisionsoptik Gera GmbH und Richard Wolf GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Fö</strong><strong>rderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 19639 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 249.600 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1140" target="_blank" title="Projektsteckbrief HSI-plus">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2025" target="_blank" title="Projektplan HSI-plus">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li>Nothelfer S, Bergmann F, Liemert A, Reitzle D, Kienle, A. Spatial frequency domain imaging using an analytical model for separation of surface and volume scattering. <i>Journal of Biomedical Optics</i> <strong>2019</strong>, 24 (7), 071604-071604 DOI: <a href="https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-biomedical-optics/volume-24/issue-07/071604/Spatial-frequency-domain-imaging-using-an-analytical-model-for-separation/10.1117/1.JBO.24.7.071604.full">10.1117/1.JBO.24.7.071604</a></li> </ul>
<p><strong>Mediale Präsenz</strong></p>
<ul> <li><a href="https://www.forschung-fom.de/fom/aktuelles/d/otto-von-guericke-preis-2020-fuer-medizintechnik-photonik-forscherteam-aus-ulm" target="_blank" title="Finalist Otto von Guericke-Preis 2020">Gewinner des Otto von Guericke-Preis 2020</a></li> <li><strong><a href="t3://page?uid=95" title="Projektfilm HSI-plus"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">Projektfilm HSI-plus 2020</span></a></strong></li> <li><a href="t3://file?uid=1180" target="_blank" title="Finalist Otto von Guericke-Preis 2020">Nominerung des Projekts für den Otto von Guericke-Preis 2020</a></li> </ul>
<p><strong>Akademische Abschlussarbeiten</strong></p>
<ul> <li>Kunz, S. (2019): "Grundlegende Untersuchungen zur Entwicklung eines kombinierten Messsystems mit strukturierter Beleuchtung und hyperspektraler Bildgebung für die Früherkennung dermaler Melanome" (Masterarbeit)</li> <li>Hank, P. (2018): "Implementierung und Charakterisierung eines Systems zur Messung der ortsaufgelösten optischen Eigenschaften in Echtzeit" (Masterarbeit)</li> <li>Meintinger, D. (2018): "Grundlegende Untersuchungen zur Entwicklung eines kombinierten Messsystems mit strukturierter Beleuchtung und hyperspektraler Bildgebung für die Früherkennung dermaler Melanome" (Masterarbeit)</li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1289"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 30.04.2020 (Webkonferenz)<br /> - 03.12.2019 (ILM, Ulm)<br /> - 14.09.2018 (ILM, Ulm)<br /> - 05.10.2017 (ILM, Ulm)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2019<br /> - Zwischenbericht für 2018<br /> - Zwischenbericht für 2017</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 17. Juni 2021 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK (Digital Edition) präsentiert.</strong></p> |
|
MiReG
Konzipierung und Validierung einer hochpräzisen 3D-Aufbautechnik für miniaturisierte optische Mikroresonator Gyroskope
|
(2017-2020)
|
F.O.
|
|
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 19619 N (2017 - 2020)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Mikrooptische Aufbauten sind hochspeziell und bis auf wenige Komponenten technologisch kaum auf andere Produkte übertragbar. Die Integration verschiedener Materialien erfordert diversifizierte Verbindungstechnologien, einen größeren Maschinenpark sowie verschieden spezialisierte Mitarbeiter. Zudem kommt es z. B. durch thermische Fehlanpassungen zu Problemen in der Produktzuverlässigkeit. Diese Schwierigkeiten führen dazu, dass design- und kundenspezifisch zu entwickelnde Prototypen und Produkte insbesondere bei geringen und mittleren Anfangsstückzahlen sehr lange und teure Entwicklungszeiten benötigen und im Falle höherer Nachfrage nicht schnell auf Volumenfertigung skalierbar sind.<br /> <br /> Interferometrisch messende und ähnliche Systeme für die Messtechnik, z. B. für Abstandsmessungen oder 3D-Tracking, sind aktuell nur in massiv ausgeführten Geräten und Anlagen möglich. Eine Miniaturisierung auf Wafer-basierte Mikrotechniken ist, größtenteils physikalisch-bedingt, nicht möglich. Eine Wafer-Level-Montage wäre zudem für kleine bis mittlere Stückzahlen nicht wirtschaftlich. Standardisiert-automatisierte Aufbautechniken zwischen diesen beiden Extremen sind bisher nicht verfügbar. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Das Ziel des Vorhabens MiReG war die Entwicklung einer thermisch unempfindlichen, generischen Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT), die sowohl Prototypen als auch Produkte mit geringen Initialkosten ermöglicht und gleichzeitig eine hohe Präzision in der Aufbautechnik und Dimensionsstabilität in kompakten photonischen Modulen im Betrieb garantiert. <br /> <br /> Für die mikro-optische und elektronische Integration sollte eine AVT aus gelasertem Dünnglas entwickelt werden, sodass auch komplexe optische Sensorsysteme aus dem kostengünstig einsetzbaren Halbzeug Dünnglas assembliert und optisch koppelnd ausgerichtet werden können. Dies sollte exemplarisch anhand eines hochpräzisen, miniaturisierten, mikro-optischen Messgeräts für den Nachweis der Erdachsendrehung (Gyroskop) gezeigt werden. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>In MiReG wurde erfolgreich eine auf Dünnglas basierende, einfach skalier- und adaptierbare Plattform für optische Sensorik entwickelt. Auf dieser Plattform können verschiedenste mikro-optische Komponenten präzise maschinell bestückt werden. Über auf dem Glas angebrachte Dünnfilm-Metallisierungen sind zusätzlich opto-elektronische und elektronische Komponenten integrierbar. <br /> <br /> Im Besonderen konnte eine Validierung der opto-elektronischen Messtechnik an optischen Resonatoren, die bei Resonanz mitschwingen, gezeigt werden. Nach anfänglich verwendeten optischen Faserresonatoren wurde im Demonstrator an einen sehr kompakten optischen Flaschenresonator gekoppelt. Dieser Resonator wurde hierzu mit verschiedenen verfeinerten Verfahren sehr formtreu aus einer Quarzglasfaser hergestellt. <br /> <br /> Die optischen Resonatoren konnten stabil in der MiReG-Plattform direkt faser-optisch angeregt und ausgelesen werden, sodass auch kleinste Veränderungen in der Umgebung durch Änderung in den Spektren nachweisbar sind (z. B. eine rotatorische Bewegung nach dem Sagnac-Prinzip).<br /> <br /> Zudem konnten feine Resonanzbreiten entsprechend optischen Güten Q von 1 Mio. an sehr kleinen Flaschenresonatoren mit 1 mm Durchmesser optisch-annähernd angeregt und abgetastet werden. Bei dieser hohen Auflösung werden bereits hohe Anforderungen an die Plattform-integrierte Elektronik gestellt. <br /> <br /> Der gesetzte Formfaktor für die Messplattform von 100 mm x 50 mm wurde eingehalten. Weiteres Miniaturisierungs-Potential war angesichts der vergleichsweise lockeren Belegung der Messplattform vorhanden, auch wenn bei Freistrahlsystemen/Interferometern am Ende auch physikalisch-optische Aspekte eine Abwägung erfordern zwischen Größe und Auflösungsfähigkeit/Reichweite des optischen Systems. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Für KMUs ist neben der maschinellen Bestückbarkeit auch der Aspekt der Miniaturisierbarkeit optischer Systeme besonders relevant. <br /> <br /> Glas als Substratmaterial für strukturierte Metalldünnfilme ist auch bei sehr hohen Frequenzen sehr verlustarm bei wesentlich kleineren Materialkosten als üblicherweise verwendete Keramiken. Für Firmen der sehr diversifizierten glasverarbeitenden Industrie, die traditionell mittelständisch aufgestellt ist, bieten sich vielfältige neue Geschäftsfelder im Bereich der Zulieferung miniaturisierter Baugruppen oder der Erweiterung der Wertschöpfungstiefe durch eigene Produkte oder Halbzeuge. <br /> <br /> Weiterhin besitzt die entwickelte hybride Aufbautechnik von mikro-optischen, opto-elektronischen und elektronischen Komponenten verschiedenster Größen auf Dünnglas ein großes Potential für Kosteneinsparungen, unabhängig der Stückzahlen der zu fertigenden Systeme. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong>einrichtung</strong></p>
<ul> <li>Technische Universität Berlin, Forschungsschwerpunkt Technologien der Mikroperipherik</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Aifotec GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Astro- und Feinwerktechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>CREAVAC GmbH</li> <li>Eagleyard Photonics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ficonTEC Service GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>FOC-fibre opt. Comp. GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>GRINTECH GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>MDI Adv. Processing GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Northrop Grumman LITEF GmbH</li> <li>OPTOCRAFT GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Schott AG</li> <li>Schröder Spezialglas GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SmarAct GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>TEM Messtechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Astro- und Feinwerktechnik GmbH, CREAVAC GmbH, Eagleyard Photonics GmbH, ficonTEC Service GmbH, MDI Adv. Processing GmbH und Schröder Spezialglas GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 19619 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 244.280 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li>Schröder H, Schwietering J, Böttger G, Zamora V. <em>Hybrid photonic system integration using thin glass platform technology</em>“ <i>Journal of Optical Microsystems</i> <strong>2021</strong>, 1 (3), 033501-033501, DOI: <a href="https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-optical-microsystems/volume-1/issue-3/033501/Hybrid-photonic-system-integration-using-thin-glass-platform-technology/10.1117/1.JOM.1.3.033501.full">10.1117/1.JOM.1.3.033501</a></li> </ul>
<p><strong>Akademische Abschlussarbeiten</strong></p>
<ul> <li>Brauda, D.: Adhesive bonding of micro-optical components with sub-micrometer precision and analysis of coupling tolerances" (Masterarbeit)</li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1278" style="color: rgb(181,21,43)">IGF-Erfolgsnote</a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 24.03.2020 (Webkonferenz)<br /> - 05.11.2019 (TU, Berlin)<br /> - 06.11.2018 (TU, Berlin)<br /> - 19.09.2017 (TU, Berlin)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2018<br /> - Zwischenbericht für 2017</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul> |
|
ISICOM
Entwicklung eines neuartigen, nicht invasiven In-situ-Kombi-Sensors zur Überwachung des metabolischen Zustands von Kultivierungsprozessen
|
(2017-2020)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 19361 N (2017 - 2020)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Biotechnologische Prozesse sind komplexe Mehrphasenprozesse, deren ganzheitliche Beschreibung nur mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand möglich ist. Zudem erfordern der steigende Pharmazeutikabedarf sowie steigende Qualitätsanforderungen in der Pharmazie- und Lebensmittelbranche eine Steigerung von Effizienz und Verlässlichkeit der Überwachung und Regelung mehrphasiger biotechnologischer Prozesse. Um solche Prozesse sicher und effizient zu gestalten, bedarf es Sensoren, die den Prozess- und insbesondere den Zellzustand möglichst nicht-invasiv und in situ erfassen. Diese Sensorkonzepte zur nicht-invasiven Echtzeiterfassung metabolischer Aktivität existieren bisher nicht.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des Projekts war die Entwicklung eines In-situ-Kombi-Sensors, der durch simultane Messung von Biomassekonzentration und pO<sub>2</sub>-Wert in einer kurzzeitig abgeschlossenen Kammer den O<sub>2</sub>-Verbrauch als Indikator des Zellzustands während der Kultivierung online ohne Probenahme ermittelt. Das Konzept des Sensors sollte auf der Miniaturisierung der dynamischen Methode beruhen: In einer Messkammer sollte ein für das gesamte Kulturzellvolumen definiertes und repräsentatives, zeitlich segmentiertes Volumenelement vom Rest der Zellsuspension aus dem Reaktor isoliert und sauerstoffdicht abgeschlossen werden. Der Sensor muss somit einen gasdichten Verschluss einer möglichst kleinen Messkammer garantieren. In der Messkammer sollten dann über Sensoren basierend auf Glasfaseroptik der pO<sub>2</sub>-Wert und die Biomassekonzentration über eine integrierte Streulichtoptode ermittelt werden, um den O<sub>2</sub>-Verbrauch zu bestimmen.<br /> <br /> Der Vorteil dieser Sensorkombination wäre, dass der Sensor bei geöffnetem Messraum als konventionelle pO<sub>2</sub>- und Streulichtoptode arbeiten kann und die von diesen Sensoren ermittelten Werte mit denen der Sensoren im Reaktor abgeglichen werden können. Bei geschlossener Messkammer ist die spezifische Sauerstoffaufnahmerate der Zellen bestimmbar, ohne den Kultivierungsprozess zu beeinflussen oder eine Probe aus dem Reaktor entnehmen zu müssen.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Der ISICOM-Sensor konnte erfolgreich entwickelt werden: Die Messkammer schließt ein definiertes Volumenelement kurzzeitig und gasdicht ein, um dort den pO<sub>2</sub>-Wert und die Biomassekonzentration simultan zu erfassen. Die simultane Erfassung wurde durch die Implementierung von zwei Messprinzipien im Sensorkopf erreicht: Zur Ermittlung des pO<sub>2</sub>-Werts wurden faseroptische Sensoren genutzt, die die sauerstoffabhängige Fluoreszenz in den Sensorspots auf der Glasscheibe der äußeren Lichtleiterführung erfassen. Der dazugehörige Lichtleiter wurde durch die innere Lichtleiterführung von hinten genau dort an die Glasscheibe geführt, wo der Sensorspot positioniert ist. Diese räumliche Trennung des Sensorspots von der optischen Faser ermöglicht ein Sterilisieren des Sensorkopfs, ohne die Sensorelektronik und die temperaturempfindlichen Lichtleiter zu zerstören. Die Biomassebestimmung erfolgt optisch mittels Trübungsmessung (180°-Streulicht). Hierfür wurde ein weiterer Lichtleiter mit dem inneren Sensorstempel an die Glasscheibe geführt, der das rückgestreute Licht und damit die Trübung in der Kammer direkt durch die Glasscheibe misst.<br /> <br /> Die spezifische Sauerstoffaufnahmerate (qOUR) von Bakterien- (E. coli), Hefe- (K. phaffi) und Tierzell- (Chinese Hamster Ovary-/CHO-)Kultivierungen konnte mit dem Sensor erstmalig online in situ bestimmt und der metabolische Zustand der Zellen über den gesamten Kultivierungsprozess ohne Probenahme erschlossen werden. Somit waren Rückschlüsse auf die Anlaufphase des Populationswachstums („Lag-Phase“), die Änderungen des metabolischen Zustands und die Produktivität der Zellen möglich.<br /> <br /> Die qOUR-Bestimmung war mit dem ISICOM-Sensor jedoch nur für geringere Zelldichten mit einer resultierenden qOUR bis zu 20 mmol/l/h) möglich. Für höhere Zelldichten erwies sich die Sauerstoffsensorik als zu langsam. Dennoch konnten auch bei hohen Zelldichten bereits durch die Online-Bestimmung der Biomasse wichtige Informationen gewonnen werden.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Biotechnologische Prozesse finden eine breite Anwendung in der (Bio-)Pharmazeutika- und Lebensmittelbranche. Während viele der in der Lebensmittelbranche tätigen Unternehmen KMU sind, steigt mit steigendem Bedarf an Pharmazeutika auch der Bedarf an neuen Sensorkonzepten, die von KMU entwickelt und geliefert werden können. Für eine zuverlässige Produktion werden Prozessanalysatoren zur Prozessüberwachung und -regelung benötigt. Der ISICOM-Sensor kann hier entscheidende Informationen zur Prozessoptimierung und -auslegung liefern: Bei der Prozessüberwachung ist mit dem Sensor eine frühzeitige Fehlchargenerkennung und optimale Endpunktbestimmung möglich, sodass Ressourcen eingespart werden können. Zudem kann durch den Online-Einsatz des Sensors bei Bedarf gezielt während der Produktion in den Prozess eingegriffen werden. In der Prozessentwicklung können durch den Einsatz des ISICOM-Sensors Entwicklungszeit und somit Entwicklungskosten eingespart werden.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong>einrichtung</strong></p>
<ul> <li>Leibniz Universität Hannover, Institut für Technische Chemie</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>art photonics GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Blue Ocean Nova AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Christian Hansen</li> <li>LabCognition, Analytical Software GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Ocean Optics BV</li> <li>PreSens - Precision Sensing GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Sanofi-Aventis Deutschland GmbH</li> <li>Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG</li> <li>Weihenstephaner Förderverein für Brau-, Getränke-, und Getreidetechnologie e. V.</li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen PreSens - Precision Sensing GmbH, Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG sowie der Weihenstephaner Förderverein für Brau-, Getränke-, und Getreidetechnologie e. V. an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWK-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 19361 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 159.130 EUR</li> </ul><p><strong>Vorhabensbeschreibung</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1141">Projektsteckbrief</a></li> <li><a href="t3://file?uid=2036" target="_blank" title="Projektplan ISICOM">Projektplan</a></li> </ul>
<p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li>Dahlmann, K., Busse, C., Aupert, F., de Vries, I., Marquard, D., Solle, D., Lammers, F., Scheper, T., Online monitoring of the cell-specific oxygen uptake rate with an in situ combi-sensor. <em>Analytical and Bioanalytical Chemistry</em> <strong>2020</strong>, 412: 2111–2121. DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/s00216-019-02260-9">10.1007/s00216-019-02260-9</a></li> </ul>
<p><strong>Akademische Abschlussarbeiten</strong></p>
<ul> <li>Dahlmann, K. (2020): "Entwicklung eines neuartigen in situ Kombisensors zur Bestimmung der zellspezifischen Sauerstoffaufnahmerate" (Dissertation)</li> <li>Ulber, N. (2019): "Entwicklung und Modifizierung eines Photometers zur Untersuchung des Sedimentationsverhaltens unterschiedlicher Zellsysteme" (Bachelorarbeit).</li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1343"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">IGF-Erfolgsnote</span></a></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 31.08.2020 (Webkonferenz)<br /> - 21.10.2019 (Leibniz Universität, Hannover)<br /> - 22.10.2018 (Leibniz Universität, Hannover)<br /> - 30.06.2017 (Leibniz Universität, Hannover)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2019<br /> - Zwischenbericht für 2018<br /> - Zwischenbericht für 2017</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2020<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster BMWi-Innovationstag Mittelstand 2019<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 9. Mai 2019 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
EFORMIN
Einsatz von Formgedächtnisaktoren in minimalinvasiven chirurgischen Instrumenten
|
(2017-2019)
|
F.O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Hochtechnologie Materialien8
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 19307 BR (2017 - 2019)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Die minimalinvasive Chirurgie (MIC) wird in der Urologie, der Gastroenterologie, der Neurochirurgie, der Thorakoskopie und in der laparoskopischen Chirurgie, wie zum Beispiel für die operative Entfernung der Gallenblase eingesetzt. Unergonomische Körperhaltungen und hohe Belastungspeaks bei der Bedienung der Instrumente verursachen körperliche Beschwerden bei den Chirurgen. Ein MIC-Instrument, welches eine intuitive Bedienung erlaubt, eine hohe Beweglichkeit und Flexibilität besitzt, war bisher nicht verfügbar.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Das Ziel des Vorhabens EFORMIN lag in der Entwicklung eines variabel-funktionalen MIC-Instrumentes, welches eine intuitive Bedienung ermöglicht und einen minimalen Arbeitskanal benötigt. Das Instrument sollte modular aufgebaut sein, bestehend aus Bedienteil, Zuleitung, Aktor und Effektor. Kernstück sollte ein auf Formgedächtnismaterialien basierendes Aktorkonzept sein.<br /> <br /> Bisherige chirurgische Instrumente sind nicht modular aufgebaut und sind nicht so konzipiert, dass sie an Nutzer oder Anwendungsfälle anpassbar sind.<br /> <br /> Formgedächtnismaterialien weisen auf kleinem Bauraum ein hohes Arbeitsvermögen auf und ihr Einsatz bietet dort Vorteile, wo Mikromotoren aufgrund ihrer Baugröße nicht einsetzbar sind.<br /> <br /> Die Aktorik und der Effektor sollten funktional getrennt sein, wodurch ein modularer Austausch verschiedener Effektoren ermöglicht werden sollte. Neben der Bewegung und der Rotation um die Längsachse sollte ein Abknicken des Effektors möglich sein.<br /> <br /> Die intuitive Bedienung des Instruments sollte im Wesentlichen durch eine verbesserte Ergonomie und ein Kraft-Feedback-System erreicht werden. Zur Verbesserung der Ergonomie sollten austauschbare Griffstücke entwickelt werden, die je nach physiologischen Anforderungen des Nutzers und des Einsatzszenarios ausgewählt werden können. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Gemeinsam mit den klinischen Partnern des projektbegleitenden Ausschusses – Chirurgen aus den Fachrichtungen HNO-Chirurgie, Laparoskopie, Wirbelsäulenchirurgie, Herz/Thorax-Chirurgie, Arthroskopie und Neurochirurgie – sind die Anforderungen an das minimalinvasive chirurgische Instrument definiert worden: Als Ziele wurden ein Außendurchmesser des Instruments von 5-8 mm und die Auswechselbarkeit der Effektoren festgelegt. Das Gesamtkonzept umfasste folglich die technischen Parameter und den Design-Entwurf und führte zur Entwicklung von drei Demonstratoren:<br /> <br /> 1. Effektormodul mit Handstück – Das durch einen Aktordraht antagonistische System wird über einen Wippenmechanismus umgesetzt. Der eingestellte Öffnungswinkel des Effektors (Zange) wurde reproduzierbar erreicht. Die benötigte Zeit für ein komplettes Öffnen und Schließen der Zange erfolgt ausreichend schnell und erfüllt die Anforderungen. Die Greifkraft wurde von den klinischen Partnern als ausreichend bewertet. Ein greifkraftabhängiges Feedback wird durch einen eingebauten Vibrationsmotor realisiert.<br /> <br /> 2. Aktormodul mit Handstück – Dieser Handdemonstrator nutzt ein Zylindergelenk, wobei die Formrückstellung durch die Federkraft des Sensordrahts erfolgt. Die vorgegebene Abwinkelung von 90 ° ist umsetzbar. Die Bestromung wird in diesem Stadium noch rudimentär über eine einfache, nicht geregelte Stromquelle realisiert.<br /> <br /> Eine Serienschaltung von Abbiege- und Effektormodul ließe sich durch Steckverbinder mit mehr Pins erzielen.<br /> <br /> 3. Tischdemonstrator – Dieser Demonstrator nutzt den Greifmechanismus konventioneller Instrumente, während die Formgedächtnislegierung (FGL)-Aktorik und Sensorik direkt an der Zug-Druck-Stange wirkt, die sonst durch manuelle Kräfte angetrieben wird. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Aufgrund des hohen Innovationspotentials dieses MIC-Instruments, insbesondere durch die Integration neuer Funktionalitäten wie das haptische Feedback für die Greifkraft, können KMU-Anbieter ein Alleinstellungsmerkmal vorweisen und sich damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.<br /> <br /> Durch den modularen Ansatz der Demonstratoren und der rein elektronischen Kopplung können weiterhin Einzelkomponenten wie der Effektor entwickelt und am Markt etabliert werden.<br /> <br /> Auch auf der Anwenderseite ist relevant, durch verschiedene Konfigurationen kostengünstig mehrere chirurgische Anwendungsfelder abzudecken. Davon profitieren gerade kleinere Kliniken, die als neue Kundengruppe bei der Vermarktung erreicht werden können. Durch den Vertrieb von MIC-Instrumenten oder Teillösungen können zudem Schulungen und Trainings für Chirurgen angeboten werden. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, Dresden</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>endocon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>joimax GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Karl Storz SE & Co. KG</li> <li>Krankenhaus Dresden Friedrichstadt</li> <li>LAKUMED</li> <li>Newkon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Olympus Surgical Technologies Europe</li> <li>radimed GmbH</li> <li>Richard Wolf GmbH</li> <li>Söring GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald, endocon GmbH, joimax GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Surgical Technologies Europe und Richard Wolf GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 19307 BR der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> </ul><p><strong>Akademische Abschlussarbeiten</strong></p>
<ul> <li>Bruns, H.: "Entwicklung einer Antriebsmechanik mit Formgedächtnislegierung für ein minimalinvasives Operationsinstrument" (Bachelorarbeit)</li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><a href="t3://file?uid=1212" style="color: rgb(181, 21, 43);"><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></a></strong></li> </ul>
<p><strong><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></strong></p>
<ul> <li><strong><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong></strong><br /> - 21.11.2019 (Fraunhofer IWU, Dresden)<br /> - 08.11.2018 (KARL STORZ Schulungs- u.<br /> Besucherzentr., Berlin)<br /> - 14.05.2018 (Fraunhofer IWU, Dresden)<br /> - 09.11.2017 (KARL STORZ Schulungs- u.<br /> Besucherzentr., Berlin)<br /> - 11.04.2017 (Fraunhofer IWU, Dresden)</li> <li><strong><strong>Zwischenberichte:</strong></strong><br /> - Zwischenbericht für 2018<br /> - Zwischenbericht für 2017</li> <li><strong><strong>Posterpräsentationen:</strong></strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster BMWi-Innovationstag Mittelstand 2019<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017</li> <li><strong><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 9. Mai 2019 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
EmmaV
Entstehungsmechanismen mittelfrequenter Fehler und deren aktive Vermeidung
|
(2017-2019)
|
F.O.
|
|
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Sonstige Metathemen13
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 18564 N (2017 - 2019)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Wesentliche technische Merkmale für hochqualitative Präzisionsoptiken sind unter anderem die Einhaltung von Toleranzen für die Formabweichung und die Rauheit. Die Abweichungen einer Oberfläche zur Sollfläche können durch die Ortsfrequenzen der Abweichungen beschrieben werden. Liegen diese im mittleren Frequenzband, zwischen der Formabweichung und der Rauheit, wird von mittelfrequenten Fehlern gesprochen (engl.: Mid-Spatial Frequency Errors – im Folgenden MSFE). MSFE führen dazu, dass Optiken auf Grund des resultierenden Beugungs- und Streulichtanteils nicht verwendet werden können. <br /> <br /> MSFE entstehen u. a. im Bearbeitungsschritt Schleifen im Punktkontakt und treten beim Polieren hervor. Beim zonalen Punktbearbeitungsverfahren von asphärischen oder Freiform-Optikflächen, mit im Verhältnis zum Werkstückdurchmesser kleinen Werkzeugabmaßen, stellen MSFE ein signifikantes Problem in der Optikfertigung anspruchsvoller Flächen dar. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Das Ziel des Vorhabens EmmaV war, die Prozessparameter, die zur Entstehung von MSFE führen, experimentell zu identifizieren. Gleichzeitig sollten mithilfe von Fehlersimulierungen Optimierung von Prozessparametern Strategien zur MSFE-Vermeidung entwickelt werden. Ein Kernstück des Projekts war der Aufbau einer Vorhersage-Software zur Auswahl eines Prozessparameter-Fensters für die Endbearbeitung von Präzisionsoptiken. Mit dieser sollten sich Strategien zur MSFE-Vermeidung für ausgewählte Fertigungsverfahren entwickeln lassen.<br /> <br /> Um die MSFE-Entstehungsmechanismen zu analysieren, wurden die Bearbeitungsschritte des Schleifens und Polierens optischer Linsen untersucht. Dafür wurden asphärische Proben in spiralförmigen Werkzeugbahnen in Punktberührung geschliffen und mit einem Polierball zonal poliert. Die Oberflächenstrukturen, die bei der Spiralbearbeitung auf der Linse entstanden, wurden mit einem Formmessgerät berührungslos und taktil gemessen.<br /> <br /> Mit einem auf Fourier-Transformation basierenden Auswertungsalgorithmus wurde dann eine MSFE-Analyse der Linsenoberfläche entlang der ursprünglichen Bearbeitungsbahn vorgenommen. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Dominante Fehler-Ortsfrequenzen, die beim Schleifen in Punktberührung auftraten, konnten so eindeutig festgestellt werden. Dadurch ließ sich der Einfluss verschiedener Bearbeitungsparameter auf die jeweiligen Fehleramplituden erfolgreich untersuchen. Umgekehrt ließen sich mithilfe des Auswertungsalgorithmus die auf der Oberfläche auftretenden Fehlerfrequenzen auf die verursachenden Bearbeitungsparameter zurückführen. So wurde u. a. gezeigt, dass höhere Drehzahlen des Schleifwerkzeugs zu geringeren Schleiffehleramplituden auf der Linsenoberfläche führen. Mit den so gewonnenen Informationen gelang es, eine Simulation zu entwickeln, mit der die beobachteten MSFE, die beim Schleifen entlang der Werkzeugbahnen entstanden, rekonstruiert werden konnten.<br /> <br /> Auf dieser Basis konnte eine Modellierungs-Software entwickelt werden, die die im Schleifprozess entstehenden MSFE auf dem Bauteil vorhersagen kann. Somit ist es für Nutzer nun möglich, die eigenen Messdaten mithilfe der Software auszuwerten und sich durch einen automatisierten Abgleich mit den modellierten MSFE-Strukturen dem Schleifparametersatz anzunähern, der die unkritischsten MSFE erzeugt. Auf diese Weise können die Schleifprozesse für unterschiedliche, unternehmensspezifische Fertigungen optimiert werden.<br /> <br /> Auch bei den Untersuchungen der MSFE-Entstehung während des Polierens ergab sich, dass die Abstände der Werkzeugbahnen und die Art der Verwendung des Polierwerkzeugs (z. B. mit unterschiedlichen Werkzeugdrehzahlen oder Anstellwinkeln) wichtige Einflussfaktoren darstellen.<br /> <br /> Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass die für das Schleifen gewählten Parameter auch zu den Haupteinflussgrößen des Auftretens von MSFE beim Polieren zählen: Entstehen während des Schleifens zunächst scheinbar unkritische sekundäre MSFE, kann es dazu kommen, dass sich diese Fehler in der Werkstückoberfläche nicht nur durch das Polieren nicht glätten lassen, sondern noch stärker hervortreten oder sogar verstärkt werden. Zur Klärung des Zusammenspiels von Schleifeffekten und Polierergebnissen bedarf es weiterer Forschung. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Spezialoptiken, wie Asphären oder Freiformlinsen, werden in Deutschland überwiegend von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) produziert. Vielfach liefern diese komplexe Hochleistungsoptiken auch an Großunternehmen und internationale Konzerne. So profitieren insbesondere KMU von den Ergebnissen des Projekts und der entwickelten Software. Diese ermöglicht die Analyse der in der unternehmensspezifischen Produktionsumgebung entstehenden MSFE sowie die zeit- und kosteneffiziente Optimierung der Schleif- und teilweise auch der Polierparameter, weswegen sich die Software auch für Kleinserien rentabel einsetzen lässt. Durch die Reduktion der notwendigen Iterationszyklen und der verringerten Ausschussraten werden auch die Produktionskosten signifikant reduziert.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Technische Hochschule Deggendorf, Labor Optical Engineering</li> <li>Hochschule Aalen, Fakultät Optik und Mechatronik, Zentrum für Optische Technologien ZOT</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>asphericon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Berliner Glas KGaA</li> <li>Carl Zeiss Jena GmbH</li> <li>Carl Zeiss SMT GmbH</li> <li>FISBA OPTIK AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>JENOPTIK Optical Systems GmbH</li> <li>Leica Camera AG</li> <li>Leica Microsystems GmbH</li> <li>Opteg GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>OptoTech Optikmaschinen GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>POG Präzisionsoptik Gera GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>Satisloh AG</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen asphericon GmbH, Berliner Glas KGaA, Carl Zeiss SMT GmbH, JENOPTIK Optical Systems GmbH, Leica Camera AG, Leica Microsystems GmbH, OptoTech Optikmaschinen GmbH, POG Präzisionsoptik Gera GmbH und Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 18564 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 475.740 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li> <p>Pohl, M., Kukso, O., Boerret, R., Rascher, R., Mid-spatial frequency error generation mechanisms and prevention strategies for the grinding process. <em>Journal of the European Optical Society-Rapid Publications </em><strong>2020</strong>, 16:19. DOI: <a href="https://link.springer.com/article/10.1186/s41476-020-00140-9">10.1186/s41476-020-00140-9</a></p> </li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><strong><strong><a href="t3://file?uid=1213" style="color: rgb(181, 21, 43);">IGF-Erfolgsnote</a></strong></strong></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 27.11.2019 (TH Deggendorf, Teisnach)<br /> - 22.05.2019 (Hochschule, Aalen)<br /> - 10.01.2018 (TH Deggendorf, Teisnach)<br /> - 06.04.2017 (TH Deggendorf, Teisnach)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2018<br /> - Zwischenbericht für 2017</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul> |
|
TWI-Stitch
Kombination von Subaperturen zur hochgenauen Vermessung asphärischer Flächen unter Verwendung eines speziell angepassten Tilted Wave Interferometers
|
(2016-2019)
|
F.O.
|
|
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 18592 N (2016 - 2019)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Eine Grundvoraussetzung für hochqualitative Präzisionsoptiken sind verlässliche Verfahren für eine präzise Oberflächenvermessung mit reproduzierbaren Ergebnissen. Ein großes Potential hierfür besitzt die optische, berührungslose Messtechnik der Interferometrie, deren Vorteil in der zerstörungsfreien, flächenhaften, genauen, hochauflösenden und schnellen Erfassung von Oberflächen liegt. Für die Fertigung großer konvexer asphärischer Präzisionsoptiken oder Freiformflächen stand bisher allerdings keine zufriedenstellende Methode zur Linsenvermessung zur Verfügung. Die Herausforderung lag dabei sowohl in der Größe dieser Komponenten, im Bereich von bis zu einem Meter Durchmesser, als auch in ihren komplexen Formen. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Das Ziel des Projekts TWI-Stitch bestand darin, eine schnelle, berührungslose Messmethode mit hoher Ortsauflösung und geringer Messunsicherheit für große asphärische Optikkomponenten zu erstellen. Diese soll für neue und innovative Produkte von z. B. lichtstarken Optiksystemen für die Fernerkundung und Hochenergieoptiken angewendet werden. Hierfür wurde im Rahmen des Projekts die Kombination zweier Verfahren untersucht, nämlich der innovativen, flexiblen Tilted Wave-Interferometrie (TWI) mit dem sogenannten „Stitching“-Verfahren. Ein Tilted Wave-Interferometer kann, im Gegensatz zu herkömmlichen Interferometern, auch stark asphärische Abweichungen in nur einer Messposition messen. Um den messbaren Durchmesser zu erweitern, werden mit dem TWI zuerst einzelne über die Messfläche verteilte Subaperturen aufgenommen. Im Anschluss werden die Einzelmessungen mittels einer im Projekt entwickelten Stitching-Algorithmik zur Gesamtmessung zusammengefügt. Durch die Fähigkeit des TWI, auch Freiformflächen messen zu können, kann mit diesem Ansatz die Anzahl der Einzelmessungen und damit die Messzeit im Vergleich zur konventionellen Stitching-Interferometrie um bis zu 90 % reduziert werden. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Für das Projekt wurde die neue Messmethode realisiert, indem ein bestehendes Granitportal mit einem TWI-Messkopf (bereitgestellt von einem Unternehmen des projektbegleitenden Ausschusses) kombiniert wurde. Im Rahmen des Projekts wurden neue, speziell für die Messaufgabe optimierte Messobjektive entworfen und hergestellt. Eine neue Kalibrierstrategie und die Fertigung mehrerer Kalibrierkugeln machten die Kalibrierung und damit reproduzierbare Messungen möglich.</br /> </br /> Es wurden drei Testflächen mit unterschiedlichen Eigenschaften definiert und gefertigt. Die Größe und das Gewicht der Prüflinge erforderte die Entwicklung eines neuen präzise justierbaren und langzeitstabilen Messmittelträgers. Sowohl die Hardware des Messkopfes als auch die Achsen des Messportals werden von der neu entwickelten Algorithmik angesteuert, sodass sowohl die Kalibrierung als auch der Messvorgang automatisiert ablaufen können. </br /> </br /> Durch Vergleichsmessungen konnten die Messergebnisse validiert werden. Ein Kipptest zeigt die Stabilität des Aufbaus, die die Voraussetzung für ein erfolgreiches Vermessen mehrerer Subaperturen ist. Durch die Erweiterung der TWI-Software um die Vorbereitung der Subaperturen und deren Einzelauswertung sowie die Entwicklung einer Stitching-Software wurden Subaperturmessungen möglich, deren Messergebnisse zusammengefügt werden. Somit ist es nun möglich, auch für sehr große Prüflinge präzise Informationen zu deren Oberflächenfehlern zu erhalten, was Grundvoraussetzung für den weiteren Bearbeitungsprozess ist. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Das in TWI-Stitch entstandene Wissen ist grundsätzlich für alle Optikhersteller interessant, die sich mit der Fertigung asphärischer Linsen und Freiformflächen beschäftigen, da diesen eine flexible und hochgenaue Messmethodik an die Hand gegeben werden kann. </br /> </br /> Durch die erhöhte Flexibilität bei den Optikherstellern entsteht neues Innovationspotential für Optikdesigner und Optikmaschinenbauer. Speziell diese Gruppen bestehen primär aus kleinen Ingenieurbüros, also vorrangig aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).</br /> </br /> Zu den Anwendungsbeispielen, für die bisher keine zufriedenstellende Messtechnik verfügbar war und die daher direkt vom Einsatz der untersuchten Messmethodik profitieren werden, gehören lichtstarke Optiksysteme für die Fernerkundung, astronomische Teleskopsysteme oder auch Hochenergieoptiken, die alle typischerweise Durchmesser größer als 300 mm aufweisen. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Technische Hochschule Deggendorf, Labor Optical Engineering</li> <li>Universität Stuttgart, Institut für Technische Optik</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>asphericon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Astro Electronic <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Berliner Glas KGaA</li> <li>DIOPTIC GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>IFasO GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LT Ultra Precision Technology GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>MAHR GmbH</li> <li>MPF-optics Ltd <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>OAT-Technologie GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen asphericon GmbH, Berliner Glas KGaA, LT Ultra Precision Technology GmbH, MPF-optics Ltd, OAT-Technologie GmbH und Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 18592 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 387.400 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikation</strong></p>
<ul> <li>Haberl A, Harsch A, Fütterer G, Liebl J, Pruß C, Rascher R , Osten W. Model based error separation of power spectral density artefacts in wavefront measurement. <em>Proc. SPIE</em> 10749, <strong>2018</strong>, 10749:244-25, DOI: <a href="https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10749/107490T/Model-based-error-separation-of-power-spectral-density-artefacts-in/10.1117/12.2321106.short?tab=ArticleLink">10.1117/12.2321106</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1041"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 29.05.2019 (TH Deggendorf, Teisnach)<br /> - 11.04.2018 (TH Deggendorf, Teisnach)<br /> - 28.09.2017 (Universität, Stuttgart)<br /> - 12.09.2016 (TH Deggendorf, Teisnach)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2018<br /> - Zwischenbericht für 2017<br /> - Zwischenbericht für 2016</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2019<br /> - Poster 1 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2018<br /> - Poster 2 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 7. Juni 2018 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
EVAPORE
Entstehungsdetektion und Vermeidungsstrategien von Mikropartikeln in Plasmabeschichtungsprozessen für die optische Industrie
|
(2016-2019)
|
F.O.
|
|
Feinmechanik, Additive Fertigung9
Sonstige Metathemen13
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 18590 N (2016 - 2019)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Mikropartikel in dielektrischen Beschichtungen für Hochleistungsoptiken führen zu Qualitätseinbußen durch höhere Lichtverluste und geringerer Leistungsverträglichkeit der Optiken bei Bestrahlung mit Laserlicht. Auch die Lebensdauer der Optiken wird verkürzt, da Partikel Delamination initiieren können. Daher steht das Problem von Partikeln und anderen Unvollkommenheiten im Fokus der Präzisionsbeschichtung.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Das Ziel des Vorhabens EVAPORE lag in der Entwicklung von experimentellen und simulatorischen Werkzeugen, um mit diesen das Prozessverständnis der Kontamination von Optiken durch Mikropartikel während Plasmabeschichtungsprozessen zu erweitern und Vermeidungsstrategien zu finden.<br /> <br /> Es sollte zum einen ein kostengünstiges optisches Messsystem zur Detektion von Partikeln auf dem Substrat entwickelt werden und der In-situ-Einsatz eines Geräts für die Beschichtungsverfahren Aufdampfen (auch plasmagestützt; engl. Ion Assisted Deposition, IAD), Magnetronsputtern (engl. Magnetron Sputtering, MS) und Ionenstrahlzerstäuben (engl. Ion Beam Sputtering, IBS) demonsstriert werden. Im Hinblick auf die Empfindlichkeit des neuen Messgeräts sollte die Detektion auch von kleinen Partikeln, bis hinunter zu 1 µm, verifiziert werden. Zum anderen sollte ein Software-Modul programmiert werden, das das Bewegungsverhalten von Partikeln im Beschichtungsprozess berechnen und darstellen kann. Aufbauend auf einem bestehenden Simulationsmodul, sollten verschiedene industrietypische Beschichtungsanlagen anhand ihrer 3D-Geometrien simuliert werden.<br /> <br /> Mit den neuen Werkzeugen sollte die Frage geklärt werden, wo und bei welchen Prozessschritten Partikel entstehen, die die Schichten kontaminieren. Darauf basierend sollten Prozessbedingungen und Maßnahmen identifiziert werden, mit denen Partikelkontamination auf dem Substrat reduziert wird.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Der Aufbau eines qualifizierten Partikelmonitors wurde für alle drei Beschichtungsverfahren, MS, IBS und IAD, erreicht. Es stehen vier Bauformen von In-situ-Partikelmonitoren zur Verfügung (s. unten links). Die Detektion von 1µm-Defekten wurde mit diesen Demonstratoren verifiziert. Durch Einsatz eines Makroobjektivs konnten auch Submikrometerpartikel detektiert werden.<br /> <br /> Es wurde eine neue Software zur Simulation von Partikeln im Inneren der Beschichtungsanlage entwickelt. Damit kann das Verhalten von großen Ensembles (Größenordnung 100.000) von Partikeln anhand der physikalischen Beschreibung der während der Beschichtung wirkenden Kräfte simuliert werden. Die Simulation generiert als Ausgabedaten die zeitaufgelösten Partikeleigenschaften und erlaubt die anschauliche Darstellung von 3D-Partikeltrajektorien in der Beschichtungskammer.<br /> <br /> Mit den entwickelten Werkzeugen wurde das Verständnis der Prozesse bei der Partikelkontamination durch Identifizierung einiger Partikelquellen erweitert. Die Simulationen des MS-Verfahrens ergaben, dass viele Partikel in das Beschichtungsplasma hineingelangen und dort verbleiben, da die elektrische Kraft die dominante Kraft auf die Teilchen ist.<br /> <br /> Bei den experimentellen Ergebnissen aus dem Partikelmonitoring zeigten sich sowohl beim MS- als auch beim IBS-Verfahren starke Abhängigkeiten vom verwendeten Beschichtungsmaterial.<br /> <br /> In-situ-Bilddaten bestätigten zudem, dass Einzelereignisse in Form von parasitären elektrischen Blitzentladungen (engl. Arcing) im Hinblick auf Partikel kritisch sind. Erstmals konnte die zeitliche Korrelation eines von der Quellensteuerung der Anlage registrierten Arcs und eines durch den Partikelmonitor detektierten neuen Defekts auf dem Substrat experimentell belegt werden.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>In diesem Projekt konnten Hypothesen zu bestimmten Einflüssen auf die Partikelkontamination, wie z. B. dem Arcing, durch direkten Nachweis im realen Beschichtungsprozess experimentell bestätigt werden. In diesem Zuge wurden Demonstratoren für innovative Werkzeuge zur Beobachtung und zur Erklärung von Partikelkontamination im Prozess realisiert und eine Simulationssoftware zur Berechnung des Bewegungsverhaltens von Partikeln programmiert.<br /> <br /> In der deutschen Beschichtungsbranche sind viele KMU vertreten, die durch Innovationen und Spezialisierung auf Sonderanfertigungen sowie die Bedienung von Nischenmärkten für High-End-Produkte auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig sind. Insbesondere für den Hochtechnologiesektor ist die Partikelkontamination während der Beschichtung von unmittelbarem Interesse. Bei den Entwicklungen in diesem Projekt wurde darauf geachtet, dass Anschaffungskosten benötigter Geräte unter 10.000 EUR liegen und diese somit auch KMU zugänglich sind.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtungen</strong></p>
<ul> <li>Laser Zentrum Hannover e. V., Hannover</li> <li>Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, Braunschweig</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Blösch AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Bühler Alzenau GmbH</li> <li>FISBA AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LASER COMPONENTS Germany GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Leica Microsystems GmbH</li> <li>Merck KGaA</li> <li>NANEO Precision IBS Coatings GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>POG Präzisionsoptik Gera GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>Rodenstock GmbH</li> <li>robeko GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Sindlhauser Materials GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Blösch AG, Bühler Alzenau GmbH, FISBA AG, LASER COMPONENTS Germany GmbH, Leica Microsystems GmbH, Merck KGaA, NANEO Precision IBS Coatings GmbH und robeko GmbH & Co. KG an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 18590 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 467.450 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li>Schulz P,Pflug A, Kricheldorf H-U. Simulation of Microparticle Motion and Contamination in Plasma Coating Systems, <em>Journal of Vacuum Science & Technology B</em> 38, <strong>2020</strong>, 022203 DOI: <a href="https://pubs.aip.org/avs/jvb/article/38/2/022203/592194/Simulation-of-microparticle-motion-and">10.1116/1.5130720</a></li> <li>Rüsseler AK, Balasa I, Kricheldorf H-U, Vergöhl M, Jensen L, Ristau D. <em>Time resolved detection of particle contamination during thin film deposition</em>, <strong>2018</strong>, Proc. SPIE 106910H. DOI: <a href="https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10691/2309918/Time-resolved-detection-of-particle-contamination-during-thin-film-deposition/10.1117/12.2309918.short">10.1117/12.2309918</a></li> <li>Rüsseler AK, Balasa I, Jensen L, Ristau D. <em>Continuous detection of particles on a rotating substrate during thin film deposition</em>, <strong>2018</strong>, Proc. SPIE 108051X. DOI: <a href="https://d-nb.info/1223090663/34">10.1117/12.2500210</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1102"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 25.06.2019 (LASER World of PHOTONICS Messe, München)<br /> - 24.10.2018 (Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG, Göttingen)<br /> - 17.10.2017 (Laser Components GmbH, Olching)<br /> - 17.03.2017 (Fraunhofer IST, Braunschweig)<br /> - 28.09.2016 (Laser Zentrum, Hannover)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2018<br /> - Zwischenbericht für 2017<br /> - Zwischenbericht für 2016</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster 1 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2018<br /> - Poster 2 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2018<br /> - Simulation BMWi-Innovationstag Mittelstand 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 7. Juni 2018 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
APERITIf
Adaptive Phasenkontrastmikroskopie zur Eliminierung des Randeffektes in Mikrotiterplatten
|
(2016-2018)
|
F.O.
|
|
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 19083 N (2016 - 2018)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Die Phasenkontrastmikroskopie, eines der wichtigsten mikroskopischen Kontrastverfahren um transparente, ungefärbte Zellen sichtbar zu machen, ist ein Durchlichtmikroskopieverfahren, bei dem eine Ringblende in den Beleuchtungsstrahlengang eingebracht und das Licht im Objektiv über einen Phasenring geleitet wird. Überlagern sich Ringblendenabbild und Phasenring, entstehen Phasenkontrastbedingungen.<br /> <br /> Bei der Zellkulturherstellung, z. B. in der Stammzellforschung, werden standardisierte Mikrotiterplatten (MTP) zur Kultivierung verwendet. Diese bestehen aus mehreren zylindrischen Einzelgefäßen, den „Wells“. Innerhalb eines Wells bildet das Nährmedium in Abhängigkeit vom Verhältnis seiner Kohäsion zur Adhäsion zur Gefäßwand in der Regel eine Oberflächenwölbung aus, so dass eine Flüssigkeitslinse entsteht. Die konkave Wölbung der Flüssigkeitslinse bewirkt sowohl Verzerrungen des Ringblendenabbildes als auch Verschiebungen durch den sich im Bildfeld verändernden Tangentialwinkel, wodurch die Überlagerung von Ringblende und Phasenring insbesondere in den stärker gewölbten Randbereichen nicht mehr in der Fläche erstreckend einzustellen ist. Dieser Effekt ist umso extremer, je kleiner der Durchmesser eines Wells ist. Das Phasenkontrastverfahren versagt hier und ein Großteil der Zellen kann nicht untersucht werden. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des IGF-Projekts APERITIf ist die vollständige Wiederherstellung des Phasenkontrasts durch eine automatische optische Kompensation der unerwünschten Effekte durch die Flüssigkeitslinse. Adaptive Phasenkontrastmikroskopie kann diese Verzerrungen und Verschiebungen rein optisch ausgleichen, indem adaptive optische Elemente in den Strahlengang eingebracht werden. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Ein adaptives, flüssigkeitsgefülltes Prisma, das im Rahmen des Projektes entwickelt wurde, wird in die Beleuchtung ein gebracht, so dass der Tangentialwinkel der Flüssigkeitslinse kompensiert werden kann. Dazu wird das Prisma über Motoren im Winkel geneigt. Ein Strahlteiler erlaubt die gleichzeitige Beobachtung von Ringblendenabbild und Phasenkontrastbild. Die Ringblende wird durch eine transmissive Flüssigkristallanzeige (LCD) erzeugt, welche wie ein Smartphone-Display funktioniert. Dadurch kann die Ringblende dynamisch als Schwarz-Weiß-Matrix erzeugt und in Position sowie Form verändert werden. <br /> <br /> Auf Basis einer kontinuierlichen Auswertung der Überlagerung im Ringblendenabbild bestimmen vollautomatische Algorithmen dann die Einstellung von Ringblende und Prisma. Die entwickelte Software erlaubt so eine automatische Aufnahme von ganzen Mikrotiterplatten mit vollautomatischer Kompensation bei verschiedenen Vergrößerungen. Dabei wird der Aufnahmebereich im Stop-and-Go-Modus abgerastert. Bei jedem Stopp wird die Art der Überlagerung durch Bildverarbeitung bestimmt, Prisma und Ringblende ausgerichtet und anschließend ein Phasenkontrastbild aufgenommen. Die Beleuchtungselemente sind in einem Adapter zusammengefasst, der sich leicht an marktübliche Mikroskope anpassen lässt.<br /> <br /> Mit diesem Ansatz konnte der Bereich, in dem Phasenkontrast möglich ist, deutlich gesteigert werden. Je nach Vergrößerung und Wellgröße können auf diese Weise mehr als das 10-fache der Fläche unter Phasenkontrastbedingungen aufgenommen werden. Damit ist es mit dieser Lösung erstmals möglich, automatisierte adaptive Phasenkontrastmikroskopie bei Standard-Mikrotiterplatten durchzuführen. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Aufgrund der weiten Verbreitung der Phasenkontrastmikroskopie als Standardverfahren ist die wirtschaftliche Bedeutung als hoch anzusehen. Zum einen ist das für die manuelle Mikroskopieanwendung an Mikrotiterplatten, zum anderen bei automatisierten Mikroskopiesystemen mit automatisierten Bildverarbeitungsroutinen relevant. Hier sind schonende Kontrastverfahren wichtig. Der Verzicht auf eine Fluoreszenzfärbung spart nicht nur Kosten und Zeit, sondern ist auch für viele Lebendzellenuntersuchungen von Vorteil, da keine externen Störfaktoren in Form von Farbstoffen vorliegen. <br /> <br /> Im Mikroskopiebereich zählen Systemintegration und Softwareentwicklung zu den Aufgabenfeldern der Gesamtsystemanbieter. Mikroskopkameras, Scanningtische und Beleuchtungen sind in der Regel Zukaufteile, die von spezialisierten Firmen entwickelt werden. Die Platzierung der Meniskuseffekt-Kompensationseinheit am Markt ist in gleicher Weise denkbar. Für die als Zulieferer in Frage kommenden Unternehmen ist eine Modularisierung des Aufbaus vorteilhaft. So können einzelne Submodule, wie das adaptive Prisma mit seiner präzisen Mechanik, von darauf spezialisierten Unternehmen, wie die Physik Instrumente GmbH & Co. KG, angeboten werden. Das gleiche gilt für die adaptive Ringblendeneinheit, bei der die Displaytechnologie der HOLOEYE Photonics AG zum Einsatz kommen kann. Die Modularisierung öffnet zudem die Technologie für KMU. So können z. B. Anbieter von Komplettsystemen auch auf KMU-produzierte Module zurückgreifen und sie in ihre Geräte integrieren. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, Aachen</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>ACQUIFER AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Advanced Light Microscopy Facility</li> <li>ALS Automated Lab Solutions GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Berliner Glas KGaA</li> <li>Eppendorf AG</li> <li>Greiner Bio-One GmbH</li> <li>HOLOEYE Photonics AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>InCelligence <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ITK Dr. Kassen GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Lead Discovery Center GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LIFE & BRAIN GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LIFE IMAGING GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GmbH</li> <li>Physik Instrumente GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen ACQUIFER AG, ALS Automated Lab Solutions GmbH, HOLOEYE Photonics GmbH, ITK Dr. Kassen GmbH, Lead Discovery Center GmbH und OLYMPUS SOFT IMAGING SOLUTIONS GbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 19083 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 183.900 EUR</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1109"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 27.04.2018 (Telefonkonferenz)<br /> - 05.12.2017 (Fraunhofer IPT, Aachen)<br /> - 12.10.2017 (Telefonkonferenz)<br /> - 16.08.2016 (Fraunhofer IPT, Aachen)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2017<br /> - Zwischenbericht für 2016</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster 1 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2018<br /> - Poster 2 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 7. Juni 2018 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
SubWell
Sub-Wellenlängenstrukturen für die Generierung zylindrischer Polarisationszustände
|
(2015-2018)
|
F.O.
|
|
Oberflächen-Funktionalisierung7
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 18728 N (2015 - 2018)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Hochleistungslaser werden als flexibles und effizientes Werkzeug für unterschiedlichste Anwendungen eingesetzt. In einer Reihe von Arbeiten konnte gezeigt werden, dass hierbei die Effizienz und Qualität der Prozesse deutlich gesteigert werden kann, wenn ein Bearbeitungslaserstrahl mit optimiertem Polarisationszustand eingesetzt wird. So konnten z. B. beim Schneiden von Metallblechen die Prozesseffizienz (bis zu 40 % mehr Schnittgeschwindigkeit) und die Qualität der Schnittkante mit radialer Polarisation deutlich verbessert werden.<br /> <br /> Daher sind neuartige diffraktive Konzepte zur Polarisationsformung und die Implementierung der entsprechenden Prozesskette für die kostengünstige Herstellung der optischen Hochleistungslaserkomponenten für zukünftige, effiziente Materialbearbeitungs- und Schweißprozesse in der Lasertechnik von hohem Interesse. <br /> <br /> Die effiziente Erzeugung solcher Polarisationszustände in Hochleistungsscheibenlasern ist allerdings bisher noch nicht gelungen. Diese kann prinzipiell Resonator-intern oder -extern (durch Polarisationskonversion) erfolgen. Die derzeit kommerziell erhältlichen Polarisationskonverter sind wegen ihrer geringen Transmissionswerte (50 - 90 %) und Schadensschwelle nicht hochleistungstauglich. Resonator-interne Konzepte für den Hochleistungsscheibenlaser zur effizienten Generierung dieser Polarisationszustände sind aktuell nicht am Markt erhältlich. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Das Ziel des IGF-Projekts SubWell war die Erforschung neuartiger Designs und Konzepte zur Polarisationsformung und die Implementierung einer Prozesskette für die kostengünstige Herstellung entsprechender optischer Hochleistungslaserkomponenten. Hierbei handelt es sich um neuartige diffraktive Sub-Wellenlängenstrukturen.<br /> <br /> Insgesamt sollten drei verschiedene Typen von Polarisationskonverter im Projekt untersucht werden. Zwei der Komponenten waren für den Resonator-internen Einsatz im Lasersystem angedacht (Gitterendspiegel, engl. grating waveguide mirror, kz. GWM, und Gitterauskoppelspiegel, engl. grating wave-guide output coupler, kz. GWOC). Die dritte Komponente sollte eine Resonator-externe Polarisationsformung ermöglichen. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>In dem IGF-Projekt SubWell wurden unterschiedliche Designs und Konzepte für die Erzeugung radialer Polarisationszustände in Hochleistungslasern sowie die Prozesskette zu deren effizienten Herstellung entwickelt. Es konnte nachgewiesen werden, dass mit dem interferenzlithographischen SBIL-Verfahren und unterschiedlichen Rezepten für das anschließende reaktive Ionenätzen in verschiedenen Materialien (SiO2 und Ta2O5) Elemente zur Polarisationsformung gefertigt werden können.<br /> <br /> Die erzeugten Demonstratorelemente (Resonator-intern einsetzbare Gitterspiegel und Gitterauskoppler) wurden in Experimenten in Hochleistungsscheibenlasersystemen erfolgreich integriert und getestet. Mit den Gitterspiegeln konnte Laserstrahlung mit max. 980 W Ausgangsleistung, einem radialen Polarisationsgrad von > 95 % und einer optischen Effizienz von ca. 53 % erzeugt werden. Mit dem Gitterauskoppler konnte radiale Laserstrahlung mit einer maximalen Ausgangsleistung von 750 W erreicht werden. Dies wurde weltweit erstmalig demonstriert und beweist die Leistungsfähigkeit des gewählten Ansatzes. <br /> <br /> Für die Herstellung Resonator-externer Polarisationskonverter wurde das SMILE-Konzept erarbeitet. In der Prozessoptimierung zur Herstellung der Elemente wurden große Fortschritte gemacht. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Laserbearbeitungsprozesse werden in immer mehr Branchen, z. B. in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Elektronikindustrie und der Medizintechnik eingesetzt. Da die Projektergebnisse eine hohe Relevanz für die gesamte photonische Prozesskette haben, können insbesondere KMU mit den Ergebnissen marktgerecht und flexibel Systeme für applikations- und kundenspezifische Anwendungen zur Verfügung stellen. <br /> <br /> In SubWell wurde eine neuartige Herstellungsmethode im Bereich der effizienten und damit kostengünstigen Generierung von leistungsfähigen Gitterstrukturen mit Dimensionen im Bereich weniger hundert Nanometer entwickelt. Dies kann von Komponentenherstellern, meist spezialisierte kleine und mittelständische Unternehmen, direkt für die Fertigung von neuartigen Polarisationsformern genutzt werden.<br /> <br /> Durch den Einsatz der Laserkomponenten ist zu erwarten, dass sich Bearbeitungszeiten beim Laserbohren, -schneiden und -tiefschweißen reduzieren, sowie sich Energieeinsparungen und Qualitätsverbesserungen ergeben. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong><strong>einrichtung</strong>en</strong></p>
<ul> <li>Universität Stuttgart, Institut für Strahlwerkzeuge IFSW</li> <li>Universität Stuttgart, Institut für Technische Optik ITO</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>AMPHOS GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Amplitude Systems S.A. <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Coherent Kaiserslautern GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>GFH GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>High Q Laser GmbH (Spectra-Physics Rankweil)</li> <li>HOLOEYE AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Ingenieurbüro Heidenreich <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Institut für Mikroelektronik Stuttgart</li> <li>TOPAG Lasertechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen AMPHOS GmbH und Coherent Kaiserslautern GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 18728 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 453.500 EUR</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1103"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote </strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 27.03.2018 (ITO Universität, Stuttgart)<br /> - 02.11.2017 (IFSW Universität, Stuttgart)<br /> - 25.07.2016 (ITO Universität, Stuttgart)<br /> - 10.11.2015 (IFSW Universität, Stuttgart)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2016<br /> - Zwischenbericht für 2015</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2018<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017<br /> - Poster 1 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2017<br /> - Poster 2 MBWi-Innovationstag Mittelstand 2017<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 18. Mai 2017 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
Opti-Bond
Integriert-Optische Module durch neue Bondtechnologien
|
(2015-2017)
|
F.O.
|
|
Feinmechanik, Additive Fertigung9
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 18360 BR (2015 - 2017)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Die moderne Optik und Photonik eröffnet vielfältige Lösungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Märkten, wie Energie, Messtechnik, Sicherheit, Mobilität, Kommunikation und den Lebenswissenschaften. Innovative Ansätze basieren vermehrt auf funktionellen Mikro- und Nanostrukturen, die durch traditionelle Aufbau- und Verbindungstechnik integriert werden müssen, zum Beispiel bei Umweltbeobachtungen mit satellitengestützten Spektrometern. Gerade solch extreme Arbeits- und Umgebungsbedingungen stellen besondere Anforderungen an die Fügetechnologien.<br /> <br /> Derzeit werden hauptsächlich die Verfahren Kleben und Ansprengen eingesetzt. Geklebte optische Systeme, bei denen brechzahlangepasste Polymere zum Fügen optischer Flächen aus Glas verwendet werden, weisen Leistungsgrenzen bei erhöhten Temperaturen, unter Vakuumbedingungen oder gegenüber leistungsstarker Laserstrahlung sowie dem Einsatz im UV-Spektralbereich auf. Ursache ist die begrenzte Materialstabilität der Polymere, die zum Beispiel durch UV-Strahlung erheblich degradieren und ausgasen. Ebenso setzen bereits geringe thermische und mechanische Belastungen die Stabilität angesprengter optischer Komponenten herab. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Um die Limitationen der herkömmlichen Fügetechnologien für Glas zu überwinden und auf die aktuellen Erfordernisse der Industrie-Applikationen zu reagieren, sollten in dem Vorhaben neue und aussichtsreiche Fügetechnologien für optische Subkomponenten entwickelt, sowie deren Möglichkeiten und Grenzen evaluiert werden. Die im Vorhaben verfolgten Verfahren sind das direkte Bonden, das silikatische Bonden und das Ultrakurzpuls-(UKP)-Laserfügen. <br /> <br /> Allen drei Fügeverfahren ist gemeinsam, dass an der Oberfläche zwischen den Fügepartnern im Ergebnis kovalente Silizium-Sauerstoff-Silizium-Brückenbindungen gebildet werden, die zu materialangepassten und hochstabilen Verbindungszonen führen. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Die schlüsselhaft ausgewählten Demonstratoren, Achromat, Strahlteiler und Faserendkappe (Abb. 1), zeigen das enorme Potential der Bondtechnologien. Die Ergebnisse zeigen, dass unterschiedliche optische Materialien mit teilweise sehr komplexen Geometrien herausragende Eigenschaften in Bezug auf Festigkeit, Maßhaltigkeit, Transmission, Langzeitstabilität und thermischer Invarianz aufweisen und entsprechend die Spezifikationen der Anwender erfüllen. Es ist möglich, ein breites Bauteilspektrum auch aus unterschiedlichen Materialien abzudecken und insbesondere werden Applikationen bei hohen Temperaturen (über 100 °C) und/oder hohen Leistungsdichten mit gekrümmten Flächen ermöglicht. Darüber hinaus wurden die Anforderungen an die Probenbeschaffenheit reduziert (Kosteneinsparung) und die Stabilität gefügter Proben gegenüber Klebe- und Ansprengtechnologien signifikant verbessert. Die entwickelten Technologien ermöglichen, angepasst an die Applikationen, eine deutliche Vereinfachung und eine signifikant schnellere Prozessierbarkeit, z. B. beim Laserfügen, bei vergleichbarer Festigkeit.<br /> <br /> Der Prozessfortschritt wurde im Folgenden auf verschiedene weitere Materialien (z. B. Borofloat, SF11, CaF<sub>2</sub>, NSF10, N-SF6) sowie auf Materialkombinationen (z. B. SiO<sub>2</sub>-Saphir, SiO<sub>2</sub>-CaF<sub>2</sub>, N-BK7 + N-SF6) übertragen, um langfristig eine breite Verwertung zu ermöglichen und neue Anwendungsfelder zu erschließen. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Die erzielten Ergebnisse sind von besonderem Nutzen für industrielle Applikationen und den Einsatz in KMUs. Die Entwicklung eines laserbasierten, spaltüberbrückenden Fügeverfahrens ermöglicht das dauerhafte und feste Verbinden selbst unterschiedlicher Fügepartner, ohne die Oberflächen der Fügepartner aufwändig auf die hohen Anforderungen des optischen Kontaktierens vorbereiten oder auf limitierende Klebeverbindungen zurückgreifen zu müssen. Die hohen Festigkeiten gestatten zudem sehr feste Verbindungen durch eine ausgedehnte Laserprozessierung der Fügefläche, sowie auch den gezielten Eintrag lokaler Bondflächen im Randbereich der zu fertigenden Komponenten, ohne Qualitätsbeeinflussung der optisch funktionellen Bereiche.<br /> <br /> Die Resultate der Untersuchungen des UKP-Laserbondens sind von wesentlicher wissenschaftlich-technischer Bedeutung für die Akteure der optischen Forschung und Industrie. Die Technologie kann insbesondere zum Verbinden optischer Elemente für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen genutzt werden, z. B. in der Medizintechnik. Das hier entwickelte Verfahren des laserbasierten Stoß-Bondens ermöglicht zusätzlich das Aneinanderfügen von Einzelelementen, wie Zylinderlinsen, zu großen optischen Komponenten und bietet so zukünftig neue Möglichkeiten der flexiblen und ökonomischen Fertigung. </p>
<p>Das IGF-Projekt Opti-Bond wurde als eines der drei aussichtsreichsten Projekte für die Endauswahl zum IGF-Projekt des Jahres 2018 ausgewählt.</p><p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong><strong>einrichtung</strong>en</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Jena</li> <li>Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Angewandte Physik</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>asphericon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Berliner Glas KGaA</li> <li>Coherent Laser Systems GmbH & Co. KG</li> <li>Hellma Optik GmbH Jena</li> <li>Laserline GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LIMO – Lissotschenko Mikrooptik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Optikron GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>POG Präzisionsoptik Gera GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG</li> <li>Trumpf Laser- und Systemtechnik GmbH</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen asphericon GmbH, Berliner Glas KGaA, Coherent Laser Systems GmbH & Co. KG, Hellma Optik GmbH Jena, Laserline GmbH, Optikron GmbH, POG Präzisionsoptik Gera GmbH, Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG und Trumpf Laser- und Systemtechnik GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 18360 BR der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 410.500 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li>Zimmermann, F, Lancry, M, Plech, A, Richter, S, Ullsperger, T, Poumellec, B, Tünnermann, A, and Nolte, S. Ultrashort pulse laser processing of silica at high repetition rates—from network change to residual strain. <em>Int J Appl Glass Sci</em>. <strong> 2017</strong>; 8: 233– 238. DOI:<a href="https://doi.org/10.1111/ijag.12221" target="_blank" title="Link to external resource: 10.1007/s00339-016-9662-1">10.1111/ijag.12221</a></li> <li>Richter, S., Naumann, F., Zimmermann, F., Tünnermann, A., Nolte, S., Appl. Phys. A <strong>2016</strong> 122: 131. DOI:<a href="https://doi.org/10.1007/s00339-016-9662-1" target="_blank" title="Link to external resource: 10.1007/s00339-016-9662-1">10.1007/s00339-016-9662-1</a></li> <li>Richter, S., Zimmermann, F., Tünnermann, A., Nolte, S., "Laser welding of glasses at high repetition rates - fundamentals and prospects", <em>Optics and Laser Technology</em> <strong>2016</strong>, 83: 59-66. DOI:<a href="https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2016.03.022" rel="noreferrer noopener" target="_blank" title="Link to external resource:10.1016/j.optlastec.2016.03.022">10.1016/j.optlastec.2016.03.022</a></li> </ul>
<p><strong>Mediale Präsenz</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1350" title="Presseinformation der AiF Opti-Bond">AiF-Pressemitteilung 2019</a></li> <li><strong><a href="t3://page?uid=95" title="Projektfilm Opti-Bond"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">Projektfilm Opti-Bond 2018</span></a></strong></li> <li><a href="t3://file?uid=1241" title="Nominierung Otto von Guericke-Preis 2018 Opti-Bond">Nominierung des Projekts für den Otto von Guericke-Preis 2018</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1117" title="IGF-Erfolgsnote Opti-Bond"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 23.11.2017 (Fraunhofer IOF, Jena)<br /> - 27.04.2017 (Fraunhofer IOF, Jena)<br /> - 03.11.2016 (Helmholtz-Gemeinschaft, Berlin)<br /> - 08.06.2016 (Messe Optatec, Frankfurt am Main)<br /> - 10.12.2015 (Fraunhofer IOF, Jena)<br /> - 21.07.2015 (Fraunhofer IOF, Jena)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2017<br /> - Zwischenbericht für 2016<br /> - Zwischenbericht für 2015</li> <li><strong>Posterpräsentatione</strong>n:<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017<br /> - Poster BMWi-Innovationstag Mittelstand 2017<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 18. Mai 2017 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
LAMETA
Weiterentwicklung einer laserbasierten Technologie für die Herstellung von Sub-Mikrostrukturen auf Metallwerkzeugen
|
(2014-2017)
|
F.O.
|
|
Oberflächen-Funktionalisierung7
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 18359 BR (2014 - 2017)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Hochauflösender und größer: Der Trend von Displays in Flachbildschirmen und Smartphones kennt seit Jahren fast ausschließlich diese Richtung. Der Bedarf an Strukturen in einer Größenordnung von einigen Nanometern bis wenigen Mikrometern auf immer größeren Flächen wächst daher stetig. <br /> <br /> Neben immer feiner skalierten Pixeln lassen sich mit derartig feinen Strukturen auch funktionale Oberflächen erzeugen: Sie erhöhen den Wirkungsgrad von Solarzellen, minimieren Reibung und Verschleiß in Automobilen, verleihen Oberflächen selbstreinigende Eigenschaften oder dienen der gezielten Oberflächenentspieglung.<br /> <br /> Die Fertigung der submikrometergroßen Strukturen mit hoher Präzision ist in vielen Bereichen noch weit entfernt von einer industriellen Umsetzung. Insbesondere in der Mikrometallbearbeitung gibt es noch wesentliche Probleme, extrem feine Mikro- und Nanostrukturen großtechnisch herzustellen. Hier spielen qualitative Aspekte wie Formstabilität der Strukturen und Wirtschaftlichkeit der Strukturerzeugung eine zentrale Rolle. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Gelingt es, mikrostrukturierte Oberflächen in einem Prozessschritt direkt auf das Werkstück einzubringen, können die Mikrostrukturen durch Replikationsprozesse massenproduktionstauglich und kostengünstig hergestellt werden.<br /> <br /> Im IGF-Vorhaben LAMETA sollte durch Optimierung der Eigenschaften eines weiter zu entwickelnden Festkörperlasers der Strukturierungsprozess so beeinflusst werden, dass präzise Strukturen im Größenbereich der Wellenlänge auf den Metalloberflächen erzeugt werden können. Hierbei wurde das Verfahren des direkten Laserinterferenzstrukturierens (Direct Laser Interference Patterning - DLIP) mit Hilfe einer, auf hohe Pulsenergien optimierten, Pikosekunden-Laserquelle verwendet. <br /> <br /> Beim DLIP-Verfahren wird der Laserstrahl einer kohärenten Laserquelle in zwei oder mehr Teilstrahlen aufgeteilt und kontrolliert auf der Bauteiloberfläche überlagert. Die resultierende, periodische Modulation der Laserintensität erlaubt das Herstellen von definierten Oberflächenmustern unterschiedlicher Topographie und Strukturdimension. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Im Rahmen von LAMETA wurden Laserquelle sowie optischer Aufbau iterativ anhand von rechnergestützten Simulationen sowie Versuchen unter produktionsnahen Bedingungen kontinuierlich angepasst. Die entwickelte Laserquelle erreicht Pulsenergien von einigen Millijoule bei Pulsdauern im 10 ps-Bereich. Die Grundwellenlänge von 1030 nm sowie die durch Frequenzverdopplung und -vervierfachung erzeugten Wellenlängen 515 und 258 nm erlauben damit ein Bearbeiten unterschiedlichster Werkstoffe. <br /> <br /> Es konnte gezeigt werden, dass sich eine Strukturierung mit einer Zielperiode bis etwa 1 μm in der Praxis als relativ einfach gestaltet. Dies betrifft neben dem weiten Parameterfeld auch die Prozessgrenzen, welche erhöhte Toleranzen bei der Anlagentechnik zulassen.<br /> <br /> Als finaler Demonstrator konnte ein Stahlflachstempel auf einer Fläche von 50 x 50 mm<sup>2</sup> mit einer Strukturperiode von 430 nm strukturiert werden. Das Abformen der Oberflächenstrukturen in Polycarbonat (PC) sowie Polydimethylsiloxan (PDMS) verdeutlicht den Nutzen des Werkzeugs zum Herstellen großflächiger Submikrometerstrukturen in kurzer Zeit. Ein industrienahes Umsetzen der funktionalen Strukturen kann in Form kompakter und robuster Gehäuse (sogenannte DLIP-Module) erfolgen. Diese DLIP-Module ermöglichen aufgrund ihrer einfachen Integrierbarkeit in bestehende Industrieanlagen eine effektive Absorption der Technologie durch Industrieunternehmen. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Die in LAMETA entwickelte Laserquelle sowie der angepasste optische Aufbau haben ihr großes Einsatzpotential bei der Werkzeugherstellung für Replikationsprozesse für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die DLIP-Technologie wurde erfolgreich weiterentwickelt und ermöglicht nun auch KMU, Werkzeuge kosteneffizient zu bearbeiten.<br /> <br /> Direkte Strukturierung von Werkstücken erfordert hohe Pulsfolgefrequenzen und hohe Pulsenergien. Das entwickelte Lasersystem ermöglicht diese. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong><strong>einrichtung</strong>en</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden</li> <li>Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V.</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen </strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>4Jet Technologies GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG</li> <li>GeSiM GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>neoLASE GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ORAFOL Fresnel Optics GmbH</li> <li>Schepers GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>temicon GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>ZETT OPTICS GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen 4Jet Technologies GmbH, BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, GeSiM GmbH, ORAFOL Fresnel Optics GmbH, Schepers GmbH & Co. KG, temicon GmbH und ZETT OPTICS GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 18359 BR der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 196.350 EUR</li> </ul><p><strong><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong> </strong></p>
<ul> <li>Eckhardt, S., Siebold, M., Lasagni, A. F., "Laser microstructured metal thin films as promising alternative for indium based transparent electrodes", <em>Optics express</em> <strong>2016</strong>, 24, 6, A553-A568.</li> <li>Siebold, M., Loeser, M., Röser, F., Albach, D., Bussmann, M., Eckhardt, S., Lasagni, A.F., Sauerbrey, R., Schramm, U., "High energy Yb: YAG active mirror laser system for transform limited pulses bridging the picosecond gap", <em>Laser & Photonics Reviews</em> <strong>2016</strong>, 10, 4, 673-680.</li> <li>Bieda, M., Siebold, M., Lasagni, A. F., "Fabrication of Sub-Micron Surface Structures on Copper, Stainless Steel and Titanium using Picosecond Laser Interference Patterning", <em>Applied Surface Science </em><strong>2016</strong>, 387, 175–182.</li> <li>Eckhardt, S., Müller-Meskamp, L., Loeser, M., Siebold, M.,Lasagni, A.F., "Fabrication of highly efficient transparent metal thin films electrodes using Direct Laser Interference Patterning", <em>Proc. SPIE 9351, Laser-based Micro- and Nanoprocessing IX, 935116</em> <strong>(March 12, 2015)</strong>, doi: 10.1117/12.2082537.</li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1121"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 20.11.2017 (Fraunhofer IWS, Dresden)<br /> - 06.12.2016 (neoLASE GmbH, Hannover)<br /> - 09.12.2015 (Fraunhofer IWS, Dresden)<br /> - 03.12.2014 (Fraunhofer IWS, Dresden)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2016<br /> - Zwischenbericht für 2015</li> <li><strong>Posterpräsentationen:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2017<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016<br /> - Poster 1 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2016<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2014</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 2. Juni 2016 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
Mitoskopie
Mitochondriales Monitoring von Stoffwechseländerungen bei neurologischen Erkrankungen mittels optischer Systeme
|
(2014-2016)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
3D-Visualisierung, Monitoring4
Detektion, Diagnostik5
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 18239 N (2014 - 2016)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Viele schwerwiegende und zunehmend volkswirtschaftlich relevante Krankheiten wie Alzheimer Demenz (AD), Diabetes und Adipositas treten vermehrt in höherem Lebensalter auf. Aufgrund bis heute nicht geklärter Ursachen und limitierter Therapiemöglichkeiten besteht folglich ein enormes Marktpotential für die Entwicklung neuer Methoden und Geräte zur Erforschung dieser Erkrankungen, zur Aufklärung der Wirkungsmechanismen von Medikamenten, sowie zur Früherkennung und Therapiekontrolle. Nach aktuellem Kenntnisstand steht die Entwicklung dieser Erkrankungen in Verbindung mit Veränderungen in den Stoffwechselprozessen in Mitochondrien. Im Falle von neurodegenerativen Erkrankungen, wie der AD, macht es die strukturelle und metabolische Komplexität von Nervenzellen notwendig, diese Prozesse zu visualisieren – zur Ursachenforschung der Erkrankungen und um Auswirkungen medikamentöser Therapieansätze verfolgen zu können. Dies stellt hinsichtlich der Erfassung verschiedener Stoffwechselparameter in lebenden Zellen hohe Anforderungen an die Untersuchungsmethode, die für die Entwicklung vielversprechender Therapieansätze unabdingbar ist. Bisher gab es kein Verfahren, das die Darstellung dieser Prozesse in lebenden Zellen und Geweben zuverlässig ermöglicht. /p></p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des IGF-Vorhabens Mitoskopie war die Entwicklung eines optischen in vitro und in vivo Screening Systems zum Monitoring von mitochondrialen Stoffwechselveränderungen in Zell- und Tiermodellen für neurodegenerative Erkrankungen. Dabei sollten parallele optische Messungen mehrerer Stoffwechselparameter zum besseren Verständnis von Veränderungen des zellulären Energiehaushalts beitragen und damit zur verbesserten Analyse in der Diagnostik und Therapie einer Vielzahl volkswirtschaftlich relevanter Erkrankungen beitragen. Das übergeordnete Ziel war die Evaluation eines Systems, das das Monitoring verschiedener Aspekte des mitochondrialen Stoffwechsels sowohl im Zellmodell, in ex vivo Maushirnschnitten als auch in vivo durch ein Glasfenster im Schädelknochen (cranial window) in transgenen Tieren ermöglicht.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Im Rahmen des IGF-Projekts Mitoskopie konnte eine innovative Kombination zweier simultaner, zeitlich und räumlich hochaufgelöster mikroskopischer Verfahren entwickelt werden, die die benötigte optische Detektion von intrazellulären Veränderungen des Metabolismus und der Atmungsleistung der Zellen ermöglichte.<br /> <br /> Die neue Methodik basiert auf dem Nachweis des sich ändernden Verhältnisses von proteingebundenem Coenzym NADH und freiem NADH, das sich beispielsweise bei Dysfunktion der Mitochondrien oder bei sauerstoffarmen Bedingungen durch den Wechsel der Energieversorgung von oxidativer Phosphorylierung zur Glykolyse vermehrt bildet. Simultane Messungen der Fluoreszenzabklingzeit von NADH und der Phosphoreszenzabklingzeit eines O<sub>2</sub>-Sensors erlauben ein optisches in vitro Screening an Hirnschnitten sowie in Zukunft auch ein in vivo Monitoring durch den Schädelknochen.<br /> <br /> Da gerade in der AD subzelluläre Unterschiede (in Nervenzellen z. B. Zellkörper versus Zellausläufer und -verbindungen) der mitochondrialen Leistung eine Rolle spielen, liefert die intrazelluläre Auflösung dieser Prozesse durch das hier entwickelte System den entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Methoden.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Insbesondere KMU, die sich mit neuen optischen Methoden zur Diagnose neurologischer Erkrankungen beschäftigen, aber auch KMU, die Diagnostika und Medikamente gegen diese Erkrankungen produzieren, profitieren nachhaltig von den erzielten Ergebnissen.<br /> <br /> Neben den produzierenden KMU und Anwendern aus Pharmazie und Forschung ermöglichen die Ergebnisse auch Dienstleistern und Zulieferern Wettbewerbsvorteile und Gewinnsteigerungen.<br /> <br /> Dieses neue Verfahren bietet über die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen hinaus großes Potential in der vorwettbewerblichen Anwendung und in anderen Bereichen der Hirnforschung und metabolischen Erkrankungen. Insbesondere durch die Erforschung des molekularen Hintergrunds mannigfaltiger metabolischer Erkrankungen bietet die Entwicklung dieser Methode eine Basis dafür, gezielt neue Medikamente zu entwickeln und zu testen.<br /> <br /> Das macht die Implementierung und Vermarktung durch Firmen in den Feldern Mikroskopie und Optik wahrscheinlich und die Verwendung für Pharmazeutische Unternehmen attraktiv.</p>
<p>Das IGF-Projekt Opti-Bond wurde als eines der drei aussichtsreichsten Projekte für die Endauswahl zum IGF-Projekt des Jahres 2016 ausgewählt.</p><p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong><strong>einrichtung</strong>en</strong></p>
<ul> <li>Universität Ulm, Core Facility für konfokale und Multiphotonen Mikroskopie</li> <li>Universität Ulm, Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Neurologie</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen </strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Aesculap AG</li> <li>alamedics GmbH & Co. KG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Becker & Hickl GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG</li> <li>Carl Zeiss Microscopy GmbH</li> <li>Photolase Europe Ltd. <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Richard Wolf GmbH</li> <li>Roche Diagnostics GmbH</li> <li>TOPTICA Photonics AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>VENTEON Laser Technologies GmbH</li> <li>Volpi AG <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>WITec Wiss. Instrum. u. Technologie GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen Aesculap AG, Becker & Hickl GmbH, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Carl Zeiss Microscopy GmbH, Photolase Europe Ltd., Richard Wolf GmbH, VENTEON Laser Technologies GmbH, Volpi AG und WITec Wiss. Instrum. u. Technologie GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF-Vorhaben Nr. 18239 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 464.900 EUR</li> </ul><p><strong>Wissenschaftliche Publikationen</strong></p>
<ul> <li>Kalinina, S., Breymayer, J., Schäfer, P., Calzia, E., Shcheslavskiy, V., Becker, W., Rück., A., "Correlative NAD(P)H-FLIM and oxygen sensing-PLIM for metabolic mapping", <em>J. Biophotonics </em><strong>2016</strong>, 9, 8, 800-811.</li> <li>Schaefer, P.M., von Einem, B., Walther, P., Calzia, E., von Arnim, C.A.F, "Metabolic Characterization of Intact Cells Reveals Intracellular Amyloid Beta but Not Its Precursor Protein to Reduce Mitochondrial Respiration", <em>PLOS ONE</em> <strong>2016</strong>, 11, 12, e0168157.</li> </ul>
<p><strong>Mediale Präsenz</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=822">AiF-Pressemitteilung 2017</a></li> <li><strong><a href="t3://page?uid=95" title="Projektfilm Mitoskopie"><span style="color: rgb(181, 21, 43); ">Projektfilm Mitoskopie 2016</span></a></strong></li> <li><a href="t3://file?uid=1184" title="Nominierung Otto-von-Guericke-Preis 2016 Mitoskopie">Nominierung des Projekts für den Otto von Guericke-Preis 2016</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1119" title="IGF-Erfolgsnote Mitoskopie"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 14.09.2016 (Universität, Ulm)<br /> - 13.10.2015 (Universität, Ulm)<br /> - 07.10.2014 (Universität, Ulm)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2016<br /> - Zwischenbericht für 2015<br /> - Zwischenbericht für 2014</li> <li><strong>Posterpräsentationen und Fachartikel:</strong><br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2016<br /> - Artikel im SPECTARIS Medizintechnik-Jahrbuch 2016<br /> - Poster 2 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2016<br /> - Poster 1 BMWi-Innovationstag Mittelstand 2016<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2015<br /> - Art. i. SPECTARIS Analysen-, Bio- u. Labortechnik-Jb. 2015<br /> - Poster 2 F.O.M.-Konferenz 2014<br /> - Poster 1 F.O.M.-Konferenz 2014</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 2. Juni 2016 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
GNOME
Aufbau eines Funktionsmusters für die Goldnanopartikelbasierte Lasertransfektion im Hochdurchsatz
|
(2014-2015)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
3D-Visualisierung, Monitoring4
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 18129 N (2014 - 2015)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Die moderne Medizin setzt vermehrt auf personalisierte Therapiestrategien, um die Wirksamkeit als auch die Selektivität der Behandlung zu erhöhen und gleichzeitig Nebenwirkungen zu reduzieren.<br /> <br /> Die Testung im Hochdurchsatz (high throughput screening, HTS) ist der zentrale Ansatz der modernen Wirkstofffindung. Hierbei werden große Durchsatzmengen an Wirkstoff-Targets und Testsubstanzen parallelisiert getestet.<br /> <br /> Der Einbringung von biologisch aktiven Molekülen in Zellen, Transfektion genannt, stellt dabei die entscheidende Basistechnologie dar. Sie erlaubt die Steuerung der Zellfunktionen, um Einblicke in die Wirkmechanismen der Testsubstanzen zu erlangen. Die HTS stellt dabei besondere Anforderungen an die Transfektionsmethode, zum Beispiel im Hinblick auf die Wirkeffizienz, die begleitende Zellschädigung und die Übertragbarkeit der Methode. Die etablierten Transfektionsmethoden können jedoch diese Anforderungen nicht vollständig erfüllen.</p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Das Ziel des IGF-Projektes GNOME war die innovative Weiterentwicklung der Goldnanopartikel-basierten Lasertransfektion (GNOME laser transfection) sowie die Umsetzung der Methode als Hochdurchsatz-Screening-Verfahren in ein automatisiertes Funktionsmuster für die molekulare Diagnostik und Therapie.<br /> <br /> Bei diesem Verfahren wird durch die Verwendung eines schwach fokussierten und rasternden Laserstrahls ein hoher Durchsatz erzielt. Hierfür werden Zellen mit Goldnanopartikeln inkubiert, um ein Sedimentieren der Partikel auf die Zellmembran zu ermöglichen. Im Anschluss werden die partikelmarkierten Zellen mit einem Laser großflächig und automatisiert abgerastert. Dabei werden die Partikel mit dem Laser angeregt und die Zellmembran durch einen Plasmonenvermittelten Effekt transient geöffnet.<br /> <br /> So können extrazelluläre Moleküle wie beispielsweise RNA oder DNA ins Zytoplasma gelangen.</p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Die Technologie konnte in Form eines Funktionsmusters etabliert und erfolgreich an einer Vielzahl verschiedener Applikationen getestet werden. Die Anwendbarkeit für Primär- und Stammzellen, wie z. B. Kardiomyozyten und neuronale Zellen, wurde demonstriert.<br /> <br /> Insgesamt wurden definierte Protokolle für 18 verschiedene Zelltypen etabliert. Zudem kann die Methode auch hoch selektiv eingesetzt werden, indem gezielt einzelne Probenbereiche bestrahlt oder Zelltypen spezifisch mit Nanopartikel markiert werden, wodurch neue Testmodalitäten, wie beispielsweise das scrape loading, realisiert werden können. Der Durchsatz mittels GNOME beträgt derzeit ca. 10.000 Zellen pro Sekunde. Damit können theoretisch derzeit 384 Wirkstoffe in einer entsprechenden Mikrotiterplatte in unter 10 Minuten pro Zelltyp getestet werden.<br /> <br /> Durch Einhaltung des Laserschutzes und die kompakte Bauweise ermöglicht das Funktionsmuster auch die Testung der Methode beim Endanwender. Zusammenfassend stellt die GNOME Lasertransfektion eine innovative Transfektionsmethode dar, welche aufgrund ihrer Alleinstellungsmerkmale in Bezug auf die Übertragbarkeit und räumliche Selektivität großes Potenzial in der HTS sowie für die Entwicklung neuartiger Testmodalitäten aufweist.</p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Das Automatisieren der Methode und die Möglichkeit der Manipulationen von Primär- und Stammzellen bringt ein hohes Potenzial, gentherapeutische Studien voranzutreiben, neue Produkte im Hochdurchsatzbereich zu entwickeln und Erkenntnisse zu gewinnen.<br /> <br /> Für Firmen, die im Feld der Hochdurchsatztestung tätig sind, ergibt sich ein deutlicher Mehrwert durch das Projekt, da sich die Anwendung von GNOME als besonders vielversprechend herausstellt: Die hohe Übertragbarkeit und die geringe Zellmortalität erschließen eine Marktbedeutung, die für Hochdurchsatztestungen (Produkte und Dienstleistungen) im Milliardenbereich liegen dürften und die durch die aktuell weitverbreitet zu verzeichnenden hohen Investitionen belegt werden. Gerade KMU können hier durch spezielle beziehungsweise zielgerichtete Problemlösungen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.<br /> <br /> Des Weiteren eröffnet die mögliche räumliche Selektion der behandelten Areale neue potenzielle Anwendungen, wie beispielsweise das „Scrape loading“, „Wound healing“-Studien oder die zelltypspezifische Transfektion, welche mit bisherigen Verfahren nicht oder nur im geringen Durchsatz erschlossen werden können. Innovative KMUs können im Bereich der Assay-Entwicklung auf dieser Basis neue Methoden entwickeln und Dienstleistungen anbieten, die einzigartig am Markt sind.</p>
<p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong>einrichtung</strong></p>
<ul> <li>Laser Zentrum Hannover e. V., Hannover</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen</strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH</li> <li>European ScreeningPort GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>IBA GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>LaVision BioTec GmbH</li> <li>LLS Rowiak LaserLabSolutions GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich alle Unternehmen an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF- Vorhaben Nr. 18129 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 238.096 EUR</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1118" title="IGF-Erfolgsnote GNOME"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Zwischenbericht:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2015</li> <li><strong>Fachartikel:</strong><br /> - Artikel im SPECTARIS Analysen-, Bio- und Labortechnik-Jahrbuch 2015</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 11. Juni 2015 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
EndoSens
Endoskopische Fasersonde zur dreidimensionalen Gewebecharakterisierung mittels Optischer Kohärenztomographie
|
(2014-2016)
|
O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
3D-Visualisierung, Monitoring4
Detektion, Diagnostik5
Opt. Messtechnik, Sensorik6
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 17998 N (2014 - 2016)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>Durch den demographischen Wandel in Deutschland hat sich die Altersstruktur der Bevölkerung in den letzten Dekaden deutlich verändert. Mit dem höheren Durchschnittsalter wird der Gelenkverschleiß (Arthrose) neben weiteren altersassoziierten Krankheitsbildern zunehmende Herausforderungen an das Gesundheitssystem stellen.<br /> <br /> Die Ursachen der Arthrose sind multifaktoriell, u. a. führen biomechanische Fehlbelastungen und Traumata zur Entstehung einer Arthrose. Der Krankheitsverlauf mit Verlust der Knorpelmatrix und Abnahme der Knorpelzellzahl ist trotz verschiedener möglicher Ursachen identisch. Durch eine frühzeitige Diagnose und darauffolgende Behandlung der Knorpeldegeneration kann die Ausbildung arthrotischer Gelenkveränderungen aufgehalten bzw. verzögert werden. <br /> <br /> Es wird also ein Diagnoseverfahren benötigt, das zerstörungsfrei intra-operativ und somit minimal-invasiv den Knorpelzustand in einem frühen Stadium der Degeneration erfassen kann. Bislang gibt es hierfür keine medizintechnischen Lösungen. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Das Ziel von EndoSens ist die quantitative Bewertung des Knorpelzustandes während der Operation durch die Entwicklung eines alternativen, leicht zu bedienenden Diagnostikwerkzeugs, das eine direkte Untersuchung und Beurteilung des Knorpelgewebes während der Arthroskopie ermöglicht. <br /> <br /> Bei der Optischen Kohärenztomographie (OCT)-Technologie handelt es sich um ein interferometrisches Punktmessverfahren, bei dem Licht mit kurzer Kohärenzlänge in das zu untersuchende Prüfobjekt eingekoppelt wird. Das verschieden stark rückgestreute Licht gibt nach Interferenz mit dem Licht aus dem Referenzarm Aufschluss über die Eigenschaften des Gewebes.<br /> <br /> Mithilfe dieser optischen Biopsie soll langfristig die Entnahme einer Gewebeprobe, deren Analyse im Labor und ein weiterer chirurgischer Eingriff zur Durchführung der Gelenktherapie vermieden werden. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Im Rahmen von EndoSens konnte die opto-mechanischen Gruppe erfolgreich aufgebaut und in ein Handstück, an das eine endoskopische Sonde angeschlossen werden kann, integriert werden.<br /> <br /> Die prinzipielle Eignung der optischen Kohärenztomografie zur histologischen Untersuchung von Knorpel wurde in zwei separaten, parallel erstellten Studien nachgewiesen. In diesen Studien wurde gezeigt, dass die mit OCT erzeugten Schnittbilder zu einer guten Deckung mit histologischen Befunden gebracht werden können. Somit ist es prinzipiell möglich, den Zustand und die Vitalität von Knorpelgewebe zerstörungsfrei und minimal invasiv mit einer endoskopischen Untersuchung zu bestimmen.<br /> <br /> Der innovative Beitrag des Vorhabens liegt in der Miniaturisierung der opto-mechanischen Baugruppe, sodass diese in das Handstück einer endoskopischen Sonde integriert werden kann. Hierdurch wurde die Möglichkeit geschaffen den Zustand und die mikroskopische Morphologie des Knorpels im Gelenk zerstörungsfrei im Rahmen einer minimal-invasiven Arthroskopie zu erfassen. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Ein hoher Nutzen der Forschungsergebnisse für KMU ergibt sich in der Vorentwicklung einer miniaturisierten opto-mechanischen Baugruppe zur Integration der OCT in die endoskopische Handsonde. Dieser zeit- sowie kostenaufwendige und risikobehaftete Prozess muss von einem KMU nicht mehr getragen werden. Stattdessen kann ein KMU auf den im Vorhaben erbrachten Ergebnissen aufbauen und ausgehend von diesen den Demonstrator zur Marktreife bringen.<br /> <br /> Die Forschungsergebnisse können von KMUs unterschiedlicher Branchen genutzt werden. Hersteller integrierter Scanspiegel können beispielsweise ihre Produkte auf die Integration kompakter handgeführter Sonden weiter anpassen. Endoskop-Hersteller, vor allem im KMU-Bereich, können die aufwendigen Überlegungen zur Integration der opto-mechanischen Baugruppe in das Handstück übernehmen und mir ihrer Expertise weiter verfeinern. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungseinrichtung</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, Aachen</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen<br /> (Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>Eberle GmbH & Co. KG</li> <li>fionec GmbH</li> <li>IT Concepts GmbH</li> <li>Klinik f. Orthopädie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen</li> <li>Volpi AG</li> <li>Xion GmbH</li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen fionec GmbH und Volpi AG an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF- Vorhaben Nr. 17998 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 172.600 EUR</li> </ul><p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1122"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Zwischenbericht:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2014</li> <li><strong>Posterpräsentationen und Fachartikel:</strong><br /> - Poster BMWi-Innovationstag Mittelstand 2016<br /> - Artikel im SPECTARIS Medizintechnik-Jahrbuch 2015</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 2. Juni 2016 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |
|
Licht als Werkzeug
Oberflächenfunktionalisierung zur Adhäsionsreduzierung von humanen Zellen auf Traumaimplantaten
|
(2013-2016)
|
F.O.M.
|
|
Medizin- und Pflegetechnik1
Laseroptische Medizintechnik2
Oberflächen-Funktionalisierung7
|
Abgeschlossene Projekte |
<p>IGF-Projekt: 17957 N (2013 - 2016)</p>
<h3>DIE HERAUSFORDERUNG</h3>
<p>In der heutigen Medizin werden zum Erhalt des Patientenwohls vermehrt medizinische Implantate verwendet. Vor allem bei der Versorgung von Frakturen werden Traumaimplantate eingesetzt, die lediglich temporär im Körper verbleiben. Die Entnahme dieser Implantate wird allerdings durch Einwachseffekte, zum Beispiel durch Osteoblasten und Fibroblasten, erschwert: <br /> <br /> Knochenzellen können eine sehr hohe Haftung zur Implantatoberfläche aufbauen, sodass ein hoher Kraftaufwand zur Entnahme notwendig wird, schwer entfernbares Gewebe die freie Sicht des Operateurs auf das zu entfernende Implantat stark einschränkt und Implantatschrauben durch eine erhöhte Haftkraft abbrechen. <br /> <br /> Eine reduzierte Zelladhäsion auf der Implantatoberfläche bei gleichbleibender Verträglichkeit bedeutet dagegen für den Patienten eine komplikationsfreiere Operation bei der Implantatentfernung, insbesondere ein reduziertes Risiko einer Nervenschädigung, gegebenenfalls kleinere Wunden, geringere Schmerzen und kürzere Wundheilungsphasen. </p>
<h3>DIE INNOVATIONSIDEE</h3>
<p>Ziel des Projekts „Licht als Werkzeug“ war die Reduzierung der Zelladhäsion beziehungsweise die Verhinderung der unerwünschten Zellanhaftung auf der Oberfläche wieder zu entfernender Traumaimplantate aus medizinischem Edelstahl durch Laser-gestützte Oberflächenfunktionalisierung sowie durch Licht-basierte Beschichtungsprozesse.<br /> <br /> Die Idee folgte jungen Forschungsergebnissen, die belegen, dass die Oberflächentopographie und die chemischen und biologischen Eigenschaften der Oberfläche einen erheblichen Einfluss auf die Zelladhäsion haben. Dies wird bei bereits realisierten Techniken zum verbesserten Einwachsen von im Körper verbleibender Implantate deutlich, wie beispielsweise das mechanische Aufrauen der Oberfläche und die Aufbringung von elektrochemischen oder PVD-Beschichtungen.<br /> <br /> In einem interdisziplinären Ansatz zwischen Materialwissenschaft, Optik, Biologie und Medizintechnik sollten UV- und VUV-lichtbasierte Verfahrensansätze geprüft und darauf aufbauend ein Prozess zur Zelladhäsionsminimierung entwickelt werden. Hierbei wurden ausschließlich biokompatible Oberflächen beziehungsweise Beschichtungen betrachtet, das heißt Systeme ohne Einsatz von gesundheitsschädlichen Ausgangssubstanzen. <br /> <br /> Dem Leitgedanken der Industriellen Gemeinschaftsforschung gemäß wurden Studien zur industriellen Machbarkeit durchgeführt, die darauf abzielten, die Adhäsionsreduzierung beispielhaft an Knochenzellen (MG-63-Osteoblasten) auf Traumaimplantaten zu evaluieren. </p>
<h3>DIE ERGEBNISSE</h3>
<p>Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von Experten für Ultrakurzpuls-Laser, Plasmabeschichtungstechnik und Zellbiologen ermöglichte hervorragende Ergebnisse: Es konnte demonstriert werden, dass sowohl die Laserstrukturierung als auch die LightPLAS-Funktionsbeschichtung, bei der eine kohlenstoffarme siliziumanorganische Schicht mit niedriger Oberflächenenergie als Endprodukt entsteht, in der Lage sind, die Zellanzahl und Zellgröße von Osteoblasten (MG-63) auf Traumaimplantaten aus medizinischem Edelstahl zu reduzieren.<br /> <br /> Bei der Beschichtung gelang dies mit einer hydrophoben, siliziumorganischen Beschichtung. Bei der Laserstrukturierung haben sich periodische, geordnete Strukturen linearer und gekreuzter Gitter als geeignet erwiesen.<br /> <br /> Die Zellanzahl konnte bis auf ca. 20 % und die zellbedeckte Fläche auf Werte unterhalb von 20 % verringert werden. Weiterhin zeigte der Vergleich zwischen beschichtetem Edelstahl und unbeschichteter Referenz eine Reduzierung bis zu 90 % für die mittlere Zellgröße. Die Zellhaftung konnte ebenso nachweislich reduziert werden, wobei die geforderte Biokompatibilität der Beschichtungen erfüllt wird.<br /> <br /> Für Titan konnten mittels Beschichtung vergleichbare Ergebnisse realisiert werden. Dies demonstriert die Übertragbarkeit auf andere Materialklassen.<br /> <br /> Erste Abschätzungen zu Kosten und Durchsatzzahlen belegen die Wirtschaftlichkeit beider Verfahren. </p>
<h3>KMU-NUTZEN</h3>
<p>Mit Hilfe dieses Forschungsvorhabens wurden den Firmen die Grundlagen zur Verfügung gestellt, im zukunftsträchtigen Bereich der Herstellung und Beschichtung von Implantatmaterial erfolgreich zu agieren.<br /> <br /> Durch die vorgeschlagenen Verfahrensansätze zur zelladhäsionsminimierenden Beschichtung von Implantatoberflächen werden vor allem kosten- und fertigungstechnische Vorteile gegenüber dem Stand der Technik erwartet.<br /> <br /> Im Bereich Dienstleistung sind die Ergebnisse insbesondere für die Auslegung von Fertigungsprozessen und für Lohnbeschichtungsunternehmen von Interesse. Speziell für die Laser-basierte Strukturierungsmethode kann aufgrund der hohen Investitionskosten die Lohnfertigung der wirtschaftlich interessantere Zugang sein. Zudem werden von den im Rahmen des Projekts erzielten Ergebnissen Anlagenbauer, Zulieferer und Anwender gleichermaßen profitieren. </p>
<p><strong>Beteiligte Forschungs</strong><strong><strong>einrichtung</strong>en</strong></p>
<ul> <li>Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen</li> <li>Laser-Laboratorium Göttingen e. V.</li> </ul>
<p><strong>Eingebundene Unternehmen </strong><br /> <strong>(Projektbegleitender Ausschuss, "PA")</strong></p>
<ul> <li>BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG</li> <li>Coherent GmbH</li> <li>Evonik Hanse GmbH</li> <li>GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG</li> <li>Heraeus Noblelight GmbH</li> <li>Induflex Coating Systems GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Klinikum Bremen Mitte gGmbH, Institut für Pharmakologie</li> <li>Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG</li> <li>Naturelize GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>Orthobion GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>SITEC Industrietechnologie GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> <li>tricumed Medizintechnik GmbH <span style="color:#993300; font-size: 10pt; "><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><sup>KMU</sup></span></span></span></li> </ul>
<p>Von diesen Unternehmen beteiligten sich die Unternehmen BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Coherent GmbH, Heraeus Noblelight GmbH, Induflex Coating Systems GmbH, Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG, Naturelize GmbH, Orthobion GmbH und SITEC Industrietechnologie GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.</p>
<p><strong>BMWi-Förderung</strong></p>
<ul> <li>Das IGF- Vorhaben Nr. 17957 N der Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.</li> <li>Fördersumme: 465.350 EUR</li> </ul><p><strong>Mediale Präsenz</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1540" title="AiF-Projektflyer Licht als Werkzeug">AiF-Projektflyer 2016</a></li> </ul>
<p><strong>Abschließende Ergebnisse</strong></p>
<ul> <li><a href="t3://file?uid=1120" title="IGF-Erfolgsnote Licht als Werkzeug"><span style="color: rgb(181, 21, 43); "><strong>IGF-Erfolgsnote</strong></span></a></li> </ul>
<p><strong>Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen</strong></p>
<ul> <li><strong>Präsentationen und Protokolle der PA-Sitzungen:</strong><br /> - 26.09.2016 (Coherent LaserSystems GmbH, Göttingen)<br /> - 21.06.2016 (BEGO Implant Systems GmbH, Bremen)<br /> - 14.01.2016 (SITEC Industrietechnologie GmbH, Chemnitz)<br /> - 14.04.2015 (Heraeus Noblelight GmbH, Hanau)<br /> - 17.09.2014 (Laser-Laboratorium, Göttingen)<br /> - 28.01.2014 (Fraunhofer IFAM, Bremen)</li> <li><strong>Zwischenberichte:</strong><br /> - Zwischenbericht für 2015<br /> - Zwischenbericht für 2014</li> <li><strong>Posterpräsentationen und Fachartikel:</strong><br /> - Poster 1 F.O.M.-Konferenz 2016<br /> - Poster 2 F.O.M.-Konferenz 2016<br /> - Artikel im SPECTARIS Medizintechnik-Jahrbuch 2016<br /> - Poster BMWi-Innovationstag Mittelstand 2016<br /> - Poster F.O.M.-Konferenz 2014</li> <li><strong>Detaillierter Abschlussbericht</strong></li> </ul>
<p><strong>Die Projektergebnisse wurden am 2. Juni 2016 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.</strong></p> |