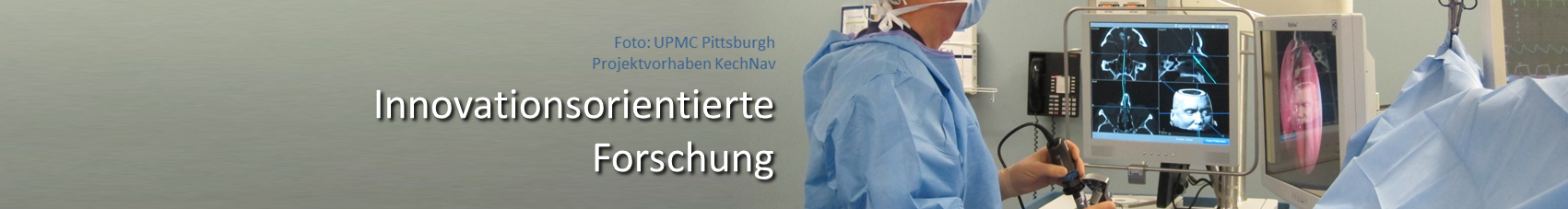
IGF-Projekt: 20302 N (2018 - 2022)
Weltweit werden jährlich über 15 Millionen Dentalimplantate eingesetzt. Dabei werden 6-16 mm lange Schrauben im Kieferknochen (= enossal) fixiert, die anschließend irreversibel festwachsen (= Osseointegration) und so die notwendige Festigkeit erlangen, um Zahnersatzkonstruktionen tragen zu können.
Allerdings können Komplikationen auftreten, z. B. bei Implantatbrüchen, Verschleiß mit daraus resultierenden Passungenauigkeiten, Entzündungen oder ästhetischen Problemen, sodass es notwendig oder sinnvoll ist, Implantate zu entfernen. Allerdings ist die Osseointegration bisher irreversibel. Zur Entfernung sind die Implantate aus dem Knochenlager herauszufräsen, was erhebliche Knochendefekte um das Implantatbett herum verursacht. Dies verschlechtert jedoch die Möglichkeiten einer implantologischen Neuversorgung erheblich.
Ein gewebeschonendes Verfahren zur Osseodisintegration, also zur Lösung von Dentalimplantaten von den mit ihnen verwachsenen Knochenzellen, wäre ein Meilenstein in der Implantologie.
Ziel war die Entwicklung eines innovativen Verfahrens zur atraumatischen Osseodisintegration enossaler Dentalimplantate. Der von ODIN verfolgte Ansatz beruhte auf einer intentionellen Lösung der strukturellen und funktionellen Verbindung zwischen Knochenzellen und Implantat durch kontrollierte Einbringung optimierter thermischer Impulse und homogener Temperatur-Ausbreitung.
Idealerweise kann eine für die effektive Lösung der Verbindung notwendige Erwärmung oder Kühlung räumlich eng auf den Bereich entlang der Implantat/Knochenzellen-Grenzfläche begrenzt werden. Durch eine dieserart erzielbare Reversibilität der Osseointegration sollen Implantate mit geringen Kräften herausgeschraubt werden können, ohne mehr als eine < 0,5 mm dünne Knochenschicht an der Grenzfläche zum Implantat zu denaturieren.
Die Innovationsentwicklung bedurfte einer Methodik zur gezielten Temperierung, numerische und experimentelle Untersuchungen bzgl. des thermischen Einflusses entlang der Grenzflächen, In-vivo-Verifizierung an Tiermodellen sowie Standardisierung eines Verfahrens.
Es wurden drei Temperierungsmethoden entwickelt, eine elektrische Erwärmung mittels Heizelement, eine Laser-optische Erwärmung mittels Dentallaser und eine Erwärmung oder Kühlung durch erzwungene Konvektion (s. Abb. unten). Der thermische Einfluss auf die Verbindungsfläche Implantat/Knochen wurde für die genannten Temperierungsmethoden zunächst artunspezifisch, dann ex vivo an realen Implantaten in Schweinekiefern und in vivo an Implantaten in Kleintieren (Ratten) und Großtieren (Schweinen) untersucht.
In dem Projekt konnte eine gleichmäßige, lokal begrenzte und damit schonende Temperierung der gängigsten Zahnimplantate erreicht werden. Dadurch konnten thermische Schädigungen von Knochen außerhalb einer < 0,5 mm dünnen Knochenschicht an der Grenzfläche zum Implantat vermieden werden. Innerhalb dieser Knochenschicht hingegen stellten sich bei denselben Temperierungsbedingungen Anzeichen für die beabsichtigte Osseodisintegration ein: Bei In-vivo-Untersuchungen an Ratten konnten mit dem Transmissionselektronenmikroskop Zellschäden in der direkten Implantatumgebung nachgewiesen werden, unabhängig von der gewählten Temperierungsmethode. Unter anderem kam es zur Schrumpfung und Ablösung von der umgebenden Knochenmatrix, teilweise zu nekrotischen Zellen, die leere Ausbuchtungen ("Lakunen") hinterließen.
Es konnte ein ideales Temperaturfenster für die Osseodisintegration der Implantate identifiziert werden, bei dem das Implantat eine Temperatur von 50 °C erreicht. Die besondere Eignung dieses Temperaturfensters wurde bei den Untersuchungen am Kleintiermodell bestätigt. Intensität und Dauer der Temperierung haben dabei einen signifikanten Einfluss auf die Homogenität der Temperaturverteilung an der Implantat/Knochen-Grenzfläche sowie an der Ausbreitung der Temperierung in den umgebenden Knochen. Eine höhere Heizleistung bei entsprechend kürzerer Aufheizzeit von z. B. < 2 Minuten führen zu einer inhomogeneren Temperaturverteilung auf der Implantatoberfläche, jedoch zu einer geringeren Penetrationstiefe der Temperierung in den Knochen und damit zu einer geringeren thermisch bedingten Knochennekrose.
Die Versuche am In-vivo-Großtiermodell lieferten keine weitere Bestätigung der Ergebnisse, da die Implantate von den Tieren nicht angenommen und herausgebissen wurden.
Die Ergebnisse von ODIN tragen zur Entwicklung neuer Geräte zur Implantat-Entfernung und für andere Anwendungen bei. So profitieren vor allem kleinere Hersteller von thermischen Quellen für verschiedene Anwendungsnischen. Auch Zahnarztpraxen profitieren durch das neue Geschäftsfeld einer gewebeschonenden Implantatextraktion. Über diese KMU-Nutzen hinaus profitieren Implantathersteller beliebiger Größe von den erarbeiteten Auslegungsempfehlungen für Osseodisintegrationsgeeignete Implantat-Innengeometrien.
Laufzeit: 01.09.2018 - 31.05.2022
Beteiligte Forschungseinrichtungen
Eingebundene Unternehmen
(Projektbegleitender Ausschuss, "PA")
Von diesen beteiligten sich die Unternehmen Bürkert Werke GmbH & Co. KG, LLS ROWIAK GmbH, Medentica GmbH sowie W & H Deutschland GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.
BMWK-Förderung
Deckung der Administrationskosten
Wissenschaftliche Publikationen
Abschließende Ergebnisse
Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen