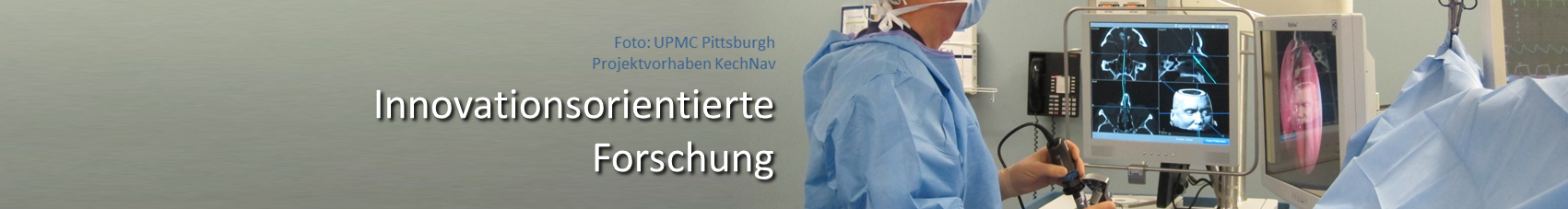
IGF-Projekt: 01IF21011N (2020 - 2022)
Glaskörpertrübungen, sog. "Mouches volantes" oder "Vitreous Floaters", führen zur Wahrnehmung kleiner, scheinbar im Gesichtsfeld schwebender Punkte oder Fäden und beeinträchtigen teilweise das Sehen. Sie entstehen durch alters- oder stressbedingte Veränderungsprozesse des Glaskörpers. Die psychische Belastung und der Verlust an Lebensqualität der Patienten können erheblich sein.
Mit der konventionellen Vitrektomie (chirurgische Entfernung von Glaskörperteilen) erzielen manche Kliniken nach eigenen Angaben Erfolgsraten über 80 %. Allerdings tritt bei diesem invasiven Ver-fahren in bis zu 60 % der Fälle Kataraktbildung (Grauer Star) auf. Auch werden Netzhaut (Retina)-Risse (bis 16,4 %) und -Ablösungen (bis 10,9 %) berichtet.
Eine augenheilkundliche Lasertherapie, die Laser-Vitreolyse, ist bisher das einzige nichtinvasive Behandlungsverfahren und nutzt einen Nanosekundenlaser zur Floater-Verdampfung. Der hohe Energieeintrag kann nach teilweiser Energieumwandlung zu mechanischen Stoßwellen und einem 'Wegspringen' der Floater führen, zur Verletzung des hinteren Kapselsacks und Kataraktbildung sowie zu einer Schädigung der Retina und Auftreten eines Glaukoms (Grüner Star). Die Häufigkeitsangabe dieser Komplikationen variiert stark, was es möglich erscheinen lässt, dass der Behandlungserfolg wesentlich von der Erfahrung des behandelnden Arztes abhängt. Bisher mangelte es an einem umfassenden Verständnis aller Vorgänge bei der Laser-Vitreolyse sowie an ausreichender Kenntnis der Parameterräume. Für eine sichere, nebenwirkungsfreie Floater-Behandlung bestand hoher Forschungsbedarf. begrenzt.
Projektziel war, die Grundlagen für ein von Augenärzten ambulant durchführbares nichtinvasives Behandlungsverfahren mit modernsten Lasern mit ultrakurzen Pulsen (UKP-Laser) zu schaffen, mit ähnlich guten Behandlungserfolgsraten wie bei der Vitrektomie und mit einer exzellenten Sicherheit bezüglich Komplikationen. Hierzu sollten Parameter von UKP-Lasersystemen für einen effizienten Abbau von Floatern optimiert und mittels optischer Kohärenztomografie (OCT) mit einer exakten 3D-Erfassung in Echtzeit für eine spätere Automatisierung der Behandlung gekoppelt werden. Der Ener-gieeintrag sollte durch fokussierte Laserpulse von mJ auf 10 μJ reduziert werden.
Ein Experimentalaufbau für eine Laser-Behandlung mit Bildgebung für den ge-samten Augapfel konnte erfolgreich auf-gebaut werden und besteht aus einem OCT-Messarm, einem Lichtfaseraufbau für die eingekoppelte Femtosekunden (fs)-Laserstrahlung und einem Arm mit Probenhalterung beziehungsweise Patienten-Interface mit Kontaktglas. Nach Synchronisation der Komponenten und Entwicklung der Software-Ansteuerung konnten untersuchte Strukturen dreidimensional erfasst und abgebildet werden. Mithilfe einer Flüssiglinse konnten die Fokusse von OCT- und fs-Laser gemeinsam um bis zu 13 mm verschoben werden, bei gleichbleibendem Strahldurchmesser. Ein solcher Aufbau erspart Vitreolyse-Patienten das unangenehme Wechseln des Patienten-Interfaces mit variierenden Brechungsstärken.
Um bei den Versuchsreihen Verfälschungen durch individuelle Floaterausprägungen zu vermeiden, wurde ein Glaskörpermodell mit einem additiv gefertigten Silikonhohlauge und einer einstellbaren Hydrogel-Füllung entwickelt. Über die Viskosität des Hydrogels lassen sich verschiedene Verflüssigungsgrade des Glaskörpers simulieren, die für die unterschiedliche Beweglichkeit der Floater verantwortlich sein könnten. Über die Geometrie der Silikon-'Hornhaut' (Cornea) wird die Brechkraft des Modellauges ohne gesonderte Linse an die des menschlichen Auges angepasst.
Zur 3D-Lokalisierung der Floater anhand von OCT-Bildern wurde ein Algorithmus entwickelt, der Floater aus den Volumendaten in Segmente zerlegt. Dies ermöglicht die Identifizierung und automatisierbare Ansteuerung geeigneter Koordinaten für die Aktivierung und Deaktivierung des Behandlungslasers. Der kontrollierbare Retina-Floater-Abstand ermöglicht die Vermeidung einer Laserpulssetzung in der Nähe sensibler Strukturen.
Für den mit dem Demonstratoraufbau realisierbaren kleinsten Fokusdurchmesser war ein Floater-Abbau durch fs-Laser bereits bei Pulsenergien ab 10 μJ und Pulsraten von 500 kHz nachzuweisen. Die fs-Laserpulse bewirkten ein deutlich selteneres Wegspringen der Floater, was auf eine geringere mechanische Beanspruchung des umliegenden Gewebes hinweist. Diese schonendere Behandlung erlaubt, Floater in größerer Nähe zu sensiblen Strukturen des Auges zu bestrahlen als bisher. Zu beachten ist jedoch, dass fs-Laser nicht-lineare Effekte erzeugen, von denen einige wissenschaftlich noch nicht vollständig erfasst sind. Die Ausschließbarkeit sichtbarer oder funktionaler Schäden der Retina durch eine fs-Laser-Vitreolyse nahe der Retina ist am effektivsten über Tierversuche nachweisbar.
Der entwickelte Aufbau unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem der aktuell verwendeten klinischen OCT-Systeme. Die Hersteller bestehender Lasersysteme zur Untersuchung von Cornea oder Retina können diese Funktionen durch geringe technische Modifikationen, wie die Erweiterung des Sichtbereichs in den Glaskörper hinein, so anpassen, dass sich zusätzlich Floater-Behandlungen mit erhöhter Verfahrenssicherheit durchführen lassen. Die Möglichkeit des Zurückgreifens auf bestehende Systeme erlaubt eine kostengünstige und schnelle Entwicklung von Modulen zur sichereren Vitreolyse. Dies lässt sich insbesondere von KMU nutzen, die bereits als Know-how-Träger, Inverkehrbringer und Zulieferer der benötigten Technologien, z. B. zur Strahlformung, Bildgebung und Laserführung, fungieren.
Die auch als "Mouches volantes", "Fliegende Mücken" oder "Floater" bezeichneten Glaskörpertrübungen des Auges können die Lebensqualität Betroffener durch eine in manchen Fällen sehr störende Beeinträchtigung des Sehens erheblich herabsetzen und dennoch wird immer wieder davon berichtet, dass sogar manche Ärzte noch heute die Einschränkungen durch die Symptome nicht ernst nähmen. Die Ursache hierfür liegt zum großen Teil an der unzureichenden Datengrundlage dieses jungen Forschungsfeldes.
Die F.O.M. und der mit ihr kooperierenden Industrieverband SPECTARIS luden daher Betroffene ein, bei der Verbesserung des Wissensstandes mitzuwirken. Durch die Teilnahme an der von F.O.M. und SPECTARIS geförderten Studie des Laser Zentrums Hannover (LZH) unterstützten bis August 2023 über 1.400 Personen unter anderem die Erfassung möglicher Entstehungsursachen und die Erstellung eines umfassenden Kataloges unterschiedlicher Ausprägungen der Glaskörpertrübungen. Diese Informationen wurden für die Forschung im Rahmen des IGF-Projekts "XFloater" der F.O.M. herangezogen und stehen auch bei der Erforschung und Entwicklung neuer Therapieansätze durch andere auf Anfrage frei zur Verfügung.
The vitreous opacities of the eye, also known as "mouches volantes" or "floaters", can considerably reduce the quality of life, and yet it is reported that some doctors do not take the restrictions caused by the symptoms seriously. The reason for this is largely due to the insufficient data base of this young field of research.
The F.O.M. and the cooperating industry association SPECTARIS sponsored a study of the Laser Zentrum Hannover (LZH) and invited affected persons to participate. The recording of possible causes of occurrence and the compilation of a comprehensive catalog of different manifestations of more than 1.400 affected supported the research of the IGF project "XFloater" of the F.O.M. The obtained data of this survey is also available for the development of new therapeutic approaches by others.
Laufzeit: 01.02.2020 - 31.10.2022
Beteiligte Forschungseinrichtung
Eingebundene Unternehmen
(Projektbegleitender Ausschuss, "PA")
Von diesen beteiligten sich die Unternehmen ARGES GmbH, Carl Zeiss Meditec GmbH, QIOPTIQ Photonics GmbH & Co. KG und Rowiak GmbH an der Deckung der auf freiwilliger Basis durch die Wirtschaft zu tragenden Administrationskosten. Die F.O.M. bedankt sich im Namen der begleitenden Branchen.
BMWK-Förderung
Deckung der Administrationskosten
Wissenschaftliche Publikationen
Abschließende Ergebnisse
Weitere Informationen für eingebundene PA-Unternehmen
Die Projektergebnisse wurden am 15. Juni 2023 auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWK in Berlin präsentiert.